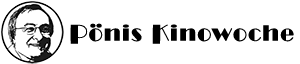PÖNIs: (3,5/5)
„THE LODGE“ von Veronika Franz und Severin Fiala (Co-B + R; GB/USA 2018; Co-B: Sergio Casci; K: Thimios Bakatakis; M: Danny Bensi, Saunder Jurriaans; 112 Minuten; deutscher Kino-Start: 06.02.2020).
Gastkritik von Caroline „Carrie“ Steinkrug
Hierbei handelt es sich um eine Co-Produktion zwischen dem amerikanischen Konzern FilmNation und dem britischen Horror-Traditionshaus Hammer Films. Letzteres wurde Mitte des vergangenen Jahrhunderts vor allem durch gotische Meisterwerke wie „Dracula“ (1958; Terence Fisher) berühmt. Unvergessen in der Titelrolle: der damals 36-jährige Christopher Lee. Nachdem es um die 1980er dann aber eher still um diese Gruselschmiede wurde, kehrte sie 2012 mit einer unvergleichlich stimmungsvollen Renaissance und der „Frau in Schwarz“ (R: James Watkins; s. Kino-KRITIK) ins Kino zurück. In diesem Fall als „English-Darling“ an vorderster Darstellerfront kein geringerer als „Harry Potter“-Daniel Radcliffe, der die kuscheligen Klassenzimmer von Hogwarts, und somit seinen Zauberumhang gegen ein verfluchtes Gemäuer im Moor eintauschte. Inklusive viktorianischem Herrenanzug. Denn eines verbindet die Hammer-Inszenierungen seit jeher: die eindrucksvolle Atmosphäre. Düster. Nebelig. Geheimnisvoll. Subjektiv. Böse.
Dies bringt heuer das Regisseuren-Team Veronika Franz und Severin Fiala ins Spiel, die zum ersten Mal mit ihrem österreichischem Horrormovie „Ich seh Ich seh“ 2015 in Erscheinung traten. Darin entwickeln zwei kleine Zwillingsbrüder ein mörderisches Misstrauen gegenüber ihrer Mutter, die nach einer vermeintlichen OP unter ihrem Gesichtsverband nicht mehr dieselbe zu sein scheint. In ausufernd langatmigen Bildern kreierte das Duo dabei eine bedrückend düstere Stimmung, die vor allem im englischsprachigen Ausland unter dem Titel „Goodnight Mommy“ einiges an Aufsehen erregte. Und da sich Gleich und Gleich bekanntlich gerne zusammengesellt, sorgte dies schließlich dafür, dass sich alle erwähnten Mitwirkenden nun in THE LODGE – einem Ferienhaus im Schnee – zum grausigen Stelldichein treffen. Doch: Stellt sich hier wirklich packende Anspannung oder eher Langeweile ein?
Die Premiere fand am 25. Januar 2019 auf dem berühmten Sundance Film Festival in Park City/Utah statt. Zuvor gedreht wurde die Hüttengaudi um eine Patchwork-Familie, die eigentlich keine sein will, in der wunderschönen und eisigen Einöde Kanadas. Ein Sinnbild der erkalteten Beziehung zwischen Stiefmama Grace, die sich so sehr ein besseres Verhältnis zu den Kindern ihres neuen Freundes Richard wünscht, und eben Aidan mit Mia, die sie jedoch für den Selbstmord ihrer Mutter verantwortlich machen. Denn „Papa“, seines Zeichens Psychologe, ging einst eine Affäre mit seiner Patientin Grace ein, die als Jugendliche nur knapp einem religiös-fanatischen Kult entkam. Und danach zu ihm in Behandlung ging. Was letztlich die Ehe und mit ihr die Familie zerstörte. Nun also: therapeutischer Zwangsurlaub in der Lodge. Ohne Vater, denn der muss in die Stadt zurück. Arbeiten. Ein Schneesturm sorgt alsbald für Abgeschiedenheit und Enge. Aber auch für den Ausbruch innerer Dämonen auf beiden Seiten, die lieber hätten begraben bleiben sollen. Wer muss sich hier ergo vor wem fürchten?
Ganz klar: Die Stimmung macht hier die Musik. Und die Musik sorgt für Stimmung. Drängt mit ihren Klängen die Bilder auf der Leinwand in Richtung des „Hereditary“ (2018) = des Vermächtnisses eines Ari Asters, der jüngst mit „Midsommar“ (2019; s. Kino-KRITIK) erneut eine furchtbar verstörende Wirkung provozierte. Aber auch Erinnerungen an die zermürbend leise Inszenierung der „Witch“ von Robert Eggers (2015; s. Kino-KRITIK) werden wach. Meister, die hier unverkennbar als Vorbilder Pate standen. Während THE LODGE es eingangs noch schafft durch plötzliche Gewalt im Kontrast mit einem innehaltenden Unbehagen eine ebenso unterschwellige Bedrohung in den Raum zu stellen, gelingt es den Spielleitern weiterführend nicht, folgegerecht daran festzuhalten. Und diese Opening-Anspannung in das spätere Holzgefängnis zu übertragen. Einerseits ist dies der Inkonsequenz vorzuwerfen, mit der sie ihre langen Einstellungen behandeln, in denen schlichtweg nichts passiert, die aber die Angst nähren; und andererseits ihrer neuerlichen Konsequenz zu verschulden, platte Horror-Klischees wie Schockeffekte oder Spukpuppenhäuser zwanghaft einbauen zu müssen. Welche die lodernde Ruhe zu gewollt brechen oder plump das brodelnde Unheimliche, das Ungewisse, die lauernden inneren Seelen-Abgründe, „in-your-face“ zerschlagen. Ein Spiel der Brutalität. Mit Erwartungen.
Dass diese auf Seiten des Publikums nicht ganz zerstört werden, ist der hervorragenden Präsenz der Hauptdarstellerin zu verdanken. RILEY KEOUGH („Mad Max: Fury Road“) als, durch ihre schlimme Vergangenheit eigentlich zerstörte Frau, in der Neu-Mutter-Rolle wankt gänsehautproduktiv zwischen der Opfer- und Täterposition hin und her. Was das Domizil inmitten eines Nirgendwo mit einer nervenzerreißend stillen Hysterie füllt, welche den Indie-Horror letztlich mehr für das Interesse einer breiteren Masse öffnet. Und nicht zu sehr ins hochtrabende Kunstspektrum abdriften lässt. Ihn nahbarer macht. Menschlicher. Nachvollziehbarer. In seiner sehr entschleunigten eher meditativen Atmosphäre. Ihr zur Seite steht „Hobbit“-Zwergenkönig RICHARD ARMITAGE, der als Daddy mehr durch Ab- als durch Anwesenheit glänzt und so wohl nur den unnahbaren Rettungsanker verkörpern soll. Unerreichbar. Zumindest emotional. Sowie LIA McHUGH als Nesthäkchen Mia beziehungsweise JAEDEN LIEBERHER („Es“; 2017) als Stiefsohn Aidan. Zwei kleine Engel, denen man nichts Fieses zutraut. Bis…
Eine verstörende letzte Szene schickt letztlich die Zuschauer nach Hause oder besser: Schließt den vermeintlichen Holzhaussarg zu. Freunde der langsamen Bilder wird es freuen. Anhänger des aktiven Angsteinflößens eher langweilen. Ich persönlich fühlte mich irgendwo zwischen Bitte-Nicht-Einschlafen und Faszination gefangen (= 3 ½ „Carrie“-PÖNIs; … eine kleine zusätzliche Warnung: Hundefreunde – wie ich – brauchen starke Nerven).