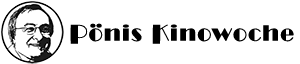PÖNIs: (4/5)
„MARRIAGE STORY“ von Noah Baumbach (B + R; USA 2018/2019; K: Robbie Ryan; M: Randy Newman; 137 Minuten; deutscher Kino-Start: 21.11.2019; Netflix-Start: 06.12.2019).
Gastkritik von Caroline „Carrie“ Steinkrug
Eine Erfolgsgeschichte, weniger inhaltlich, denn dort geht es ums Scheitern, als für den Film an sich. Dahinter steht: Noah Baumbach, geboren am 3. September 1969 in Brooklyn/New York. Bekannt durch filmische Psycho-Studien wie „Der Tintenfisch und der Wal“ (2005; s. Kino-KRITIK); „Greenberg“ (2010; s. Kino-KRITIK); natürlich: „Frances Ha“ (2012; mit der unglaublichen Greta Gerwig in der Titelrolle; s. Kino-KRITIK); „Gefühlt Mitte Zwanzig“ (2014; s. Kino-KRITIK) oder „Mistress America“ (2015; s. Kino-KRITIK). Nun also eine Tragikomödie über das Ende einer Lebensgemeinschaft: MARRIAGE STORY. Szenen einer Ehe (das gleichnamige schwedische Drama von Ingmar Bergman aus dem Jahr 1972 winkt fröhlich aus dem Archiv), die zum ersten Mal am 29. August 2019 die Leinwand der Filmfestspiele von Venedig zierten, um im Anschluss daran weiterführend die Zuschauer beim Toronto International Film Festival zu begeistern, bevor sie ab dem 6. Dezember 2019 in das Programm des Streaming-Anbieters Netflix aufgenommen wurden. Netflix – ein Unternehmen, das mit seinen eigenen Erzeugnissen, zu welchen auch dieses gehört, einen Siegeszug nach dem nächsten feiert. Mit Martin Scorseses Meisterwerk „The Irishman“, mit Robert De Niro und Al Pacino als Mafia-Schlachtschiffe (2019; s. Kino-KRITIK), oder mit Anthony Hopkins (als Papst Benedikt XVI.) sowie Jonathan Pryce (als Franzikus) in „Zwei Päpste“ (2019), macht sich dieser Video-on-Demand-Gigant sowohl bei den „Golden Globes“ wie auch bei den „Oscars“ 2020 selbst die größte Konkurrenz. Alle 3 Werke sind inzwischen nominiert. Auf das Konto von MARRIAGE STORY gehen u.a. bisher 6 „Globe“-Nominierungen: „Bester Film – Drama“; „Bestes Drehbuch“/Noah Baumbach; „Bester Hauptdarsteller“/Adam Driver; „Beste Hauptdarstellerin“/Scarlett Johansson; „Beste Filmmusik“/Randy Newman und „Beste Nebendarstellerin“/Laura Dern, die ihn am 05.01.2020 daraufhin auch gewann. Die „Oscar“-Berufungen in den wichtigsten Kategorien – „Bester Hauptdarsteller“; „Beste Hauptdarstellerin“; „Bester Film“ – sowie in den Nebenkategorien: „Beste Nebendarstellerin“; „Beste Filmmusik“; „Bestes Originaldrehbuch“ folgten alsbald. Zudem zusätzlich: die Aufnahme in die Top 10 der besten Filme 2019 durch das American Film Institute. Um nur einen kleinen Einblick in die Ehrungen zu geben, für welche die Produktion, nach einer pflichtgemäßen kurzen Kinophase, durchaus berechtigt ist. Doch sind sie auch gerechtfertigt?
Ein Paar trennt sich. So intensiv wie sie sich einst geliebt haben. In einem intimen Prozess, an dem wir Teil haben dürfen. Anfangs „nur“ auf privater, einvernehmlicher Ebene, dann öffentlich im Kampfring der Anwaltstitanen. Der Advokaten des Teufels. Etwas, das sich schon lange angebahnt hat, denn: Sie, Nicole (SCARLETT JOHANSSON) hat viel aufgegeben um ihm, Charlie (ADAM DRIVER), einem erfolgreichen Broadway-Regisseur, eine Karriere zu ermöglichen. Während er dachte: Sie erträumt es sich genau-so – dieses Leben – lagen Wunsch und Wirklichkeit jedoch weit auseinander. Somit staute sich Wut auf, die sich nun in der, durch die Scheidungsjuristen aufgeheizten Stimmung entlädt (hervorragend kühl im Paragraphenkrieg unterwegs: LAURA DERN und RAY LIOTTA). Zwei Anzugtragende-Raubtiere die sich fortan auf die Kadaver der ausblutenden Emotionen und zerfetzen Besitztümer ihrer Mandanten stürzen, um für ihre jeweilige Partei das größte, saftigste Stück herauszureißen. Das Filet: Henry, der gemeinsame Sohn. Das Opfer „Kind“ in einem verletzenden Streit ums Sorgerecht.
Mehr Inhalt braucht es nicht, denn was folgt ist ein packendes Schicht-für-Schicht-Sezieren der Innenwelt einer einstigen Einheit, die nun qualvoll zerfällt. Natürlich werden sofort Erinnerungen wach an den „Rosenkrieg“ zwischen Michael Douglas und Kathleen Turner im gleichnamigen Film (s. Kino-KRITIK) oder an Dustin Hoffman, der sich mit Meryl Streep „Oscar“-reif 1979 in „Kramer gegen Kramer“ zoffte. Aber hier geht es um mehr. Die „Preiskuh“ ist das eigene (Leid-)Wesen, das um Überwasser kämpft. Ums Überleben. Wie tiefschichtig, wie nahbar, wie intensiv, wie gnadenlos ehrlich d a s erzählt wird ist ganz großes Kino. Die beiden überragenden Mimen SCARLETT JOHANSSON und ADAM DRIVER (beide zurecht für die großen Awards nominiert) nehmen uns, die Schmerzvoyeure, immer weiter mit hinein in die angehäufte Unzufriedenheit, den unsensiblen Groll, aber auch in die Liebe zueinander, die der Regisseur direkt an den Anfang stellt. Als gemeinsamen Mittel- respektive Schnittpunkt inszeniert. Dabei wechseln ständig die Perspektiven. Und mit ihnen verrückt sich die Solidarität gegenüber den Figuren. Hin und her … von einem Lager zum anderen. Die eigene moralische Position verschiebt sich immer wieder und verdeutlicht: hier k a n n es keinen Sieger geben.
Diese ganze Intimität mündet schließlich in einem der stärksten Dialoge des letzten Jahres, in dem beide Schauspieler einen beeindruckenden Seelenstriptease vollführen. Im Anschluss: Musik und Gesang. Jeweils ein Song über die eigene Verfassung. In einem Augenblick, in welchem die Empfindungen nicht mehr durch Sprache getragen werden können. Stephen Sondheims Beziehungsmusical „Company“ (1979) erklingt. Sie singt: „You could drive a person crazy“ („Du könntest eine Person verrückt machen“) und thematisiert damit die Abnabelung von einem narzisstischen Partner. Er hingegen lässt in einer fast leeren Bar bedächtig anklingen: „Being alive“ – „am Leben sein“ … in der Hoffnung irgendwann wieder Liebesglück empfinden zu können. Selten so mit-gefühlt. Mit-erlebt. Mit-gelitten.
Und so wehmütig, traurig das alles auch klingt. Es ist am Ende kein triefender Post-mortem-Klagegesang auf eine Romanze. Es ist die wahrhafte, ehrliche Chronik einer verlorenen Ehe, die eben nicht durch den Tod, sondern durch das Leben geschieden wurde. Eine Art herber „Woody Allen“ mit präzisen komplexen Charakterzeichnungen. Eine frustrierte Auseinandersetzung zwischen Herz und Kopf, die in sich eine tragische Ironie birgt: brüllend laut und komisch zu gleich. Dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Eine Achterbahn zwischen „zweisam“ und „einsam“, aber eben nicht mehr „gemeinsam“. Division ist Disziplin. Manchmal. Im höchst grausamsten Maße. Und überwältigend (un-)menschlich zugleich. Nahe. Gehend. Dank der gnadenlos spürbaren Ehrlichkeit in den Gesichtern des Ensembles (= 2 + 2 in Trennung lebende „Carrie“-PÖNIs, die gemeinsam 4 ergeben).