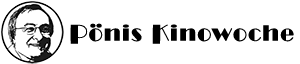PÖNIs: (2/5)
„THE GRUDGE“ von Nicolas Pesce (B + R; USA 2018; Co-Produzent: Sam Raimi; K: Zachary Galler; M: The Newton Brothers; 93 Minuten; deutscher Kino-Start: 09.01.2020).
Gastkritik von Caroline „Carrie“ Steinkrug
Es war einmal … in Japan, einem sehr dem Horror-Genre zugeneigten Filmland, als ein Schreckenstypus entstand, der sich atmosphärisch dermaßen von den gewohnten, westlichen Produktionen unterschied, dass er hier „drüben“ für eine Welle der verstörten Begeisterung sorgte. Weil eben: visuell andersartig. Verschroben in einer unkonventionellen Ästhetik. Eines der populärsten Hierfür-Beispiele erblickte 1998 das Licht der Welt: JU-ON. Der Fluch. Entstanden aus Kurzfilm-Ideen des Regisseurs Takashi Shimizu. Erfolgreiche Screenings des daraus entwickelten Spielfilms (2002) auf dem Scream-Festival in den USA oder auf dem Fantasy Filmfest in Deutschland führten dazu, dass bald darauf „natürlich“ auch ein amerikanisches Remake unter dem Titel THE GRUDGE entstand (s. Kino-KRITIK; auch unter der Leitung von Shimizu), das dem Original aber in Skurrilität, Kreativität und Divergenz nicht das Wasser reichen konnte. Da aber der, zu dieser Zeit, durch die Vampirjäger-Serie „Buffy“, sehr populäre Teenie-Star Sarah Michelle Gellar die Hauptrolle übernahm, stimmte die Kasse trotzdem einigermaßen und es folgte „na klar“ Teil 2. Und dann Teil 3. Das Ju-on-The-Grudge-Franchise war zum Ab- und finanziellen Ausschlachten fortan und weltweit bereit.
Nun folgt 2020 ein Quasi-Weiterer-Teil. Als Reboot – als sanierter Neu-Start. Ganz im Sinne des aktuellen Nochmal-von-vorn-Booms, der schon im letzten Jahr vor zahlreichen anderen Angst-Klassikern wie „Child`s Play“ (mit Chucky, der Mörderpuppe) oder „Friedhof der Kuscheltiere“ (s. Kino-KRITIK) keinen Halt machte. Und auch Bernhard Roses „Candyman“ von 1992 hat sich bereits mit seinem Honigschnütchen und Yahya Abdul-Mateen II (“Auquaman“/2018; „Wir“/2019) als Zugpferd für Juni 2020 wieder angekündigt. Es nimmt also kein Ende. Vorerst. Wortwörtlich: ein „Grudge“ … oder ein Segen?
Zunächst: Alles wie gehabt. Um die Jahre 2004 bis 2006. Ein verteufeltes Haus. In einem amerikanischen Vorort. Der Ur-Ur-Ursprung: eine verschmähte Liebe. Zumindest, wenn man den ersten Legenden glauben mag. Die Folge: Eine Art rachsüchtiger, unglückseliger Fluch, dem Detective Muldoon (ANDREA RISEBOROUGH) versucht, auf die Schliche zu kommen. Nicht zuletzt, um ihren kleinen Sohn zu beschützen. Die Abgründe sind tief und blutig. Denn das fiese Ding bringt alles um, was nicht bei Drei auf den Bäumen ist. Und sein Heim betritt. Dann treibt es die Bewohner oder Gäste in einen grausamen Selbstmord, nachdem sie schreckliche Taten begannen haben. Wie das Töten der eigenen Familie. Als Gespenster existieren sie dann alle trotzdem irgendwie weiter und erschrecken die nachfolgenden Verdammten, welche – natürlich – ebenfalls sowohl in das Gebäude als auch in diesen schrecklichen Kreislauf geraten.
Zusammenfassend: Der 29-jährige Amerikaner NICOLAS PESCE ist ein Frischling auf dem Regie-Stuhl, im Gegensatz zu seinem geklauten Sujet. Die Mutter eines Spuks, der stets ein blasses „Geschöpf“ mit langen schwarzen, fettigen beziehungsweise nass-triefenden Haaren über dem Gesicht, in den Fokus rückt. Zusammen mit einem in der Kehle knatternden Geräusch, das oft dessen Erscheinen ankündigt. Diese Grundregeln erleben auch hier keine Renaissance, sondern bleiben in ihren längst bekannten Strukturen stecken. Und kopieren als Möchte-Gern-Anders-Sein-Movie die aus der Reihe bereits bekannten, nicht-chronologischen Erzählstrukturen, die, wie Jack aus der Box aus einer angefangenen Geschichte … schwupps … eine weitere hervorzaubern. Eine Art Matrjoschka-Storyline, aus der plötzlich und immer wieder ein kleineres, diffizileres Thema ploppt, das sich vorrangig um menschliche Dramen dreht wie: Der Verlust eines geliebten Menschen, die Demenz-Erkrankung eines Ehepartners oder die Behinderung eines ungeborenen Kindes. Mit dem Herausschälen dieser Problematiken ist der Film in seinen dafür viel zu knapp bemessenen 1 ½ Stunden so sehr beschäftigt, dass er darüber vergisst das zu sein, was er sein soll: gruselig. Langeweile macht sich breit, die auch nicht durch (sehr vorhersehbare) Jump-Scares gebrochen werden kann. Die vorrangig versuchen, das letzte Drittel zu „begeistern“. Ohne Erfolg.
Auch wenn das Setting anfangs recht gut aufgebaut wird, der „geistreiche“ Antagonist zeitlos seinen Old-School-Charme beibehält, THE NEWTON BROTHERS (zuletzt: „Dr. Sleep“/2019) musikalisch durchaus erfolgreich mit-gruseln, die All-Time-Horror-Favoritin LYN SHAYE (u.a. „Insidious 1-4“) nimmermüde als Irre-Person ihr verschrobenes Schauspiel-Bestes gibt und auch der Rest ganz gut mitspielt, stirbt das Mädchen-mit-Nasenbluten-Movie in seiner verschachtelten Zeitebenen-Dramaturgie einen langsamen Spannungstod. Begeht quasi Suizid in seinen eigenen Charakter-Übertreibungen, angesichts derer andere furchterregende Immobilien wie das „Overlook Hotel“ aus Stanley Kubricks „Shining“ nur müde lächeln können.
THE GRUDGE – im Anwesen 44 Reyburn Drive ist eine Verfemung aus dem Winterschlussverkauf mit einer wütenden Heimsuchenden, die schon tausendfach aus irgendeiner Klischee-Schublade gezogen wurde. Ein Buh von der Stange. Mehrfach reduziert. Ein Blick auf den japanischen Ur-Sprung lohnt sich hingegen jederzeit. Ebenso wie auf das Ur-Gestein-Shaye und die ein, zwei ganz netten, weil bizarren, Ur-Ju-on-Grusel-Abziehbilder (= 2 „Carrie“-PÖNIs; …immer diese uninspirierten Neuauflagen – Verflucht nochmal!).