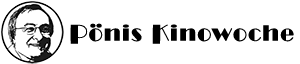„DIE SPRACHE DES HERZENS – DAS LEBEN DER MARIE HEURTIN“ von Jean-Pierre Améris (Co-B + R; Fr 2013; Co-B: Philippe Blasband; K: Virginie Saint-Martin; M: die Cellistin Sonia Wieder-Atherton; 98 Minuten; Start D: 01.01.2015); es ist für mich einer der erschütterndsten Filme, die je gedreht wurden. Präziser: Es handelt sich bei „Johnny zieht in den Krieg“ von Dalton Trumbo aus dem Jahr 1971 (s. Heimkino-KRITIK) neben „Im Westen nichts Neues“ um den wahrscheinlich besten, weil wirkungsvollsten (amerikanischen) Antikriegsfilm aller Zeiten. Joe, ein junger Amerikaner, zieht „engagiert“ in den Ersten Weltkrieg. Und kommt als „Torso“ zurück: Mit zerstörtem Gesicht, ohne Arme und Beine, der Rumpf ohne Augen, Nase, Mund und Ohren. Nur das Gehirn funktioniert noch. Und vermag „zu sprechen“. Unglaublich. Einer der berührendsten Menschen-Filme aller Zeiten. Ein weiterer kommt jetzt hinzu.
„DIE SPRACHE DES HERZENS – DAS LEBEN DER MARIE HEURTIN“ von Jean-Pierre Améris (Co-B + R; Fr 2013; Co-B: Philippe Blasband; K: Virginie Saint-Martin; M: die Cellistin Sonia Wieder-Atherton; 98 Minuten; Start D: 01.01.2015); es ist für mich einer der erschütterndsten Filme, die je gedreht wurden. Präziser: Es handelt sich bei „Johnny zieht in den Krieg“ von Dalton Trumbo aus dem Jahr 1971 (s. Heimkino-KRITIK) neben „Im Westen nichts Neues“ um den wahrscheinlich besten, weil wirkungsvollsten (amerikanischen) Antikriegsfilm aller Zeiten. Joe, ein junger Amerikaner, zieht „engagiert“ in den Ersten Weltkrieg. Und kommt als „Torso“ zurück: Mit zerstörtem Gesicht, ohne Arme und Beine, der Rumpf ohne Augen, Nase, Mund und Ohren. Nur das Gehirn funktioniert noch. Und vermag „zu sprechen“. Unglaublich. Einer der berührendsten Menschen-Filme aller Zeiten. Ein weiterer kommt jetzt hinzu.
Marie Heurtin wird am 13. April 1885 in der französischen Gemeinde Vertou (Département Loire-Atlantique) blind und taub geboren. Die Eltern überlassen sie meistens sich selbst, sind völlig überfordert und geben Marie schließlich 14jährig an die Nonnen des Instituts „Schwestern der Weisheit“ ab. Dort kommt Marie in die Obhut von Schwester Marguerite (ISABELLE CARRÉ), die – drückt man es nach heutigen Verbalmaßstäben aus – sofort „einen Narren“ an dem ungestümen Wesen „gefressen“ hat. „Heute bin ich einer Seele begegnet“, notiert sie in ihr Tagebuch nach ihrer ersten Begegnung mit Marie. Und beginnt sich intensiv um das junge Mädchen zu kümmern. Dabei ist die kommunikative Zusammenarbeit der Beiden von erheblichem Misstrauen seitens der Schwester Oberin und zudem von vielen „vergeblichen Versuchen“, sprich Rückschlägen, begleitet. Zumal die glühende Idealistin Marguerite an Schwindsucht leidet, also ein ziemliches gesundheitliches Risiko mit dieser „Betreuung“ auf sich nimmt. Doch ein Zurück kommt für sie überhaupt nicht infrage. Die Gebärdensprache wird zur Vermittlung, ein altes Taschenmesser zur ersten Vokabel. „Die Explosion der Sprache“, wie es Schwester Marguerite später nennen wird, nimmt ihren Lauf.
Der Mensch lebt. Das Herz schlägt. In einem Körper mit lauter „Fehlfunktionen“. Dennoch: Kommunikation, und sei sie noch so schwierig, ist möglich. Was folgt, ist das Glück von erster Berührung. Aus der Fortführung entsteht eine innige Freundschaft. Diese jedoch sorgt für Irritationen an diesem Ort. Schließlich hat die Schwester Saint-Marguerite mit ihrem Gelübde sich einem Anderen – fest – versprochen. Es bedarf viel Feingefühl, konsequenter Fürsorge, vor allem extremer Geduld und noch mehr Vertrauen, wenn ein Miteinander, gleich das Zueinander, gelingen soll. Und die vielen andauernden Zweifel gebrochen werden können.
Ein völlig anderer Film. In unseren großspurigen, hektischen und oft sehr lauten modernen Kino-Zeiten. Auf den einzulassen in eine völlig andere „spektakuläre“ Emotionswelt einzutauchen bedeutet. Gefüllt voller Ruhe, mit enormer, aber faszinierender Geduld und einer außergewöhnlichen Behutsamkeit. Spannung entsteht auf der einfühlsamen, wunderbaren Gefühlsskala von Sinn durch Zärtlichkeit. Zuneigung. Vertrauen.
Vom Mensch-Sein und Mensch-Werden könnte das gute, intensive Kino-Stück auch heißen. Das mit sanften Pastellfarben und unaufdringlichen Streicherklängen (von der Cellistin Sonia Wieder-Atherton) eine intensive berührende Atmosphäre entstehen lässt. Während „an der Rampe“ zwei außergewöhnlich ausdrucksstarke Charakter-Darstellerinnen imponieren: Die Debütantin ARIANA RIVOIRE, die selbst gehörlos zur Welt kam, überzeugt mit ihrer unbändigen sensiblen Kraft als Marie; ISABELLE CARRÉ („Die Anonymen Romantiker“) beeindruckt als Schwester Marguerite mit ihrer alle Grenzen sprengenden Seelen-Kraft. Was für ein „plausibles“ Gespann.
Co-Autor und Regisseur Jean-Pierre Améris („Die Anonymen Romantiker“/2010) hat einen sehr, sehr reichen und wunderschönen Menschen-Film geschaffen (= 4 ½ PÖNIs).