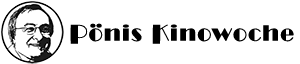Mit nur zwei Filmen haben die Brüder Joel und Ethan Coen das Genre-Kino, das Kino der bloßen Unterhaltung, schräg und schrill revolutioniert. Nach “Blood Simple“ und “Arizona Junior“ heißt jetzt ihr dritter munterer Streich: „MILLER’S CROSSING“ Joel & Ethan Coen (B+R; USA 1990; 115 Minuten; Start D: 14.02.1991).
Mit nur zwei Filmen haben die Brüder Joel und Ethan Coen das Genre-Kino, das Kino der bloßen Unterhaltung, schräg und schrill revolutioniert. Nach “Blood Simple“ und “Arizona Junior“ heißt jetzt ihr dritter munterer Streich: „MILLER’S CROSSING“ Joel & Ethan Coen (B+R; USA 1990; 115 Minuten; Start D: 14.02.1991).
Die Story und ihre Beteiligten präzise vorzustellen, ist nicht ganz einfach, denn hinter dem, was wir sehen, gibt es laufend Symbole, Doppeldeutigkeiten, Zitate und Anspielungen zu entdecken. Und die detailliert aufzudecken, würde bedeuten, zu viel vorweg verraten zu wollen. Deshalb nur so viel: „Miller’s Crossing“ ist ein Gangsterfilm als phantasievolle Entdeckungsreise. Wir schreiben das Jahr 1929, und wir befinden uns in irgendeiner Stadt im amerikanischen Osten. Es ist die Zeit der Prohibition, des Alkoholverbots, und der bullige Leo Albert Finney regiert die Stadt. Aber seine Regentschaft ist durch den schmierigen, aber mächtigen italienischen Schurken Johnny Caspar in Gefahr. Es beginnt ein Duell zwischen den Beiden steht Tom, gespielt vor Gabriel Byrne. Ein windiger, pfiffiger Lakai, der mehr mit dem Kopf als mit dem Revolver arbeitet und deshalb auch des Öfteren reichlich Prügel bezieht. Und dann gibt es noch Verna, die Leo und Tom gleichermaßen nicht nur den Kopf verdreht hat, sondern damit auch ihren Bruder Bernie retten will, der zu hoch gepokert hat und gekillt werden soll. Das ist, wie gesagt, der Ausgangspunkt, der äußerliche Rahmen, für ein witziges, böses, schönes und illustres Ränke-Spiel.
Während Coppola die italienische Oper als Mafia-Szenario zelebriert, während Scorsese auf die dichte Gewalt als Mafia-Philosophie setzt, geht es bei den Brüdern Coen um augenzwinkernde, schmucke Kommentare. Nichts ist oder entwickelt sich so, wie man es vermutet, der Zuschauer ist gefordert mitzumachen, mitzudenken, sich an der “anderen“ Wiederbelebung der “Schwarzen Serie“-Motive zu erfreuen. Dabei sind die Dialoge ein Juwel, auch in der Synchronfassung, und lassen breiten Interpretationsraum. „Miller’s Crossing“ hat was mit Jean-Pierre Melville und seinem “eiskalten Engel“ zu tun, besitzt in seiner traumatischen Personen-Kälte Shakespeare-Format, erinnert an die Samurai-Filme von Kurosawa, “Yojimbo“ und Sergio Leone, “Für eine handvoll Dollar“, und ist grandioses prächtiges Erzählkino mit exzellenten Schauspielern
(= 4 ½ PÖNIs).