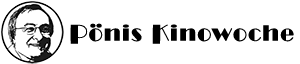„EIN LETZTER JOB“ von James Marsh (GB 2018; B: Joe Penhall; basierend auf dem Zeitungsartikel „The Over the Hill Mob“ von Mark Seal in „Vanity Fair“/2016; K: Danny Cohen; M: Benjamin Wallfisch; 107 Minuten; deutscher Kino-Start: 25.04.2019); die Geschichte klingt in der Tat Film-verlockend: Der „Hatton Garden Raub“ bescherte Großbritannien 2015 einen der spektakulärsten Kriminalfälle in der jüngeren Kriminalgeschichte. Während der Ostertage drang eine Gruppe von älteren Herrschaften durch einen Aufzugsschacht in das Gebäude der „Hatton Garden Safe Deposit Company“ im Londoner Diamanten-Viertel ein, um rund 200 Millionen britische Pfund – bar, per Schmuck und in Diamanten – aus den Schließfächern zu erbeuten. Allerdings stellten sie sich hinterher derart dämlich, überheblich und untereinander zerstritten an, dass ihnen die Polizei bald auf die Schliche kam. Behauptet jedenfalls der Film.
„EIN LETZTER JOB“ von James Marsh (GB 2018; B: Joe Penhall; basierend auf dem Zeitungsartikel „The Over the Hill Mob“ von Mark Seal in „Vanity Fair“/2016; K: Danny Cohen; M: Benjamin Wallfisch; 107 Minuten; deutscher Kino-Start: 25.04.2019); die Geschichte klingt in der Tat Film-verlockend: Der „Hatton Garden Raub“ bescherte Großbritannien 2015 einen der spektakulärsten Kriminalfälle in der jüngeren Kriminalgeschichte. Während der Ostertage drang eine Gruppe von älteren Herrschaften durch einen Aufzugsschacht in das Gebäude der „Hatton Garden Safe Deposit Company“ im Londoner Diamanten-Viertel ein, um rund 200 Millionen britische Pfund – bar, per Schmuck und in Diamanten – aus den Schließfächern zu erbeuten. Allerdings stellten sie sich hinterher derart dämlich, überheblich und untereinander zerstritten an, dass ihnen die Polizei bald auf die Schliche kam. Behauptet jedenfalls der Film.
Der zunächst nach Krimispiel, Spannung und briten-schwarze Ironie-Atmosphäre riecht, doch an allen Ecken und Enden patzt. Weder Suspense noch Pointen noch überhaupt einen gewissen Spannungs-Humor-Rhythmus zu entwerfen vermag. „Ein letzter Job“ präsentiert stattdessen von Anfang an arrogant-dämliche, sich selbst überschätzende Gangster-Oldies, mit denen die Leinwand-Begegnung eher schmerzhaft und nervig als denn originell und witzig ist. Motto: die unangenehmen Alten und ihr Dauer-Pöbeln. Alte Sackgesichter, die sich nicht ausstehen können und dies auch permanent – also bis zum Geht-Nicht-Mehr – ohne Nuancen präsentieren. Simpel vorführen. Und mehr wie Marionetten auftreten, die offensichtlich von einem wenig talentierten Puppenspieler läppisch bewegt werden. Das Drehbuch funktioniert vorne und hinten nicht; die Inszenierung ist behäbig, klobig, wirr und im wahrsten Sinne hüftsteif; man glaubt niemandem auch nur irgendetwas. Dauer-Langeweile-pur. Dabei ist der Spielleiter immerhin der 55-jährige JAMES MARSH, auch hierzulande bekannt und geschätzt wegen Filmen wie „Shadow Dancer“ (2013/s. Kino-KRITIK) und „Die Entdeckung der Unendlichkeit“ (2014/s. Kino-KRITIK; aus dem Leben von Stephen Hawking). Marsh kriegt hier die Identitäts- beziehungsweise Unterhaltungskurve nie pfiffig hin: Komödie oder Thriller? Oder beides? Oder gar eine – dann allerdings humorfreie – Parodie? Oder gar eine „geheime“ Tragödie? Bitte, was soll’s denn sein? „Ein letzter Job“, der Film, gibt darauf keine Antwort.
Und dies bei solch einem hochkarätigen Ensemble: der mehrfache „Oscar“- und „Golden Globe“-Preisträger Sir MICHAEL CAINE, inzwischen 85, mimt beiläufig den „King of Thieves“, wie der Film im Original heißt, den „König der Diebe“ (wie seine wahre Figur, Brian Reader, tituliert wurde); Sir MICHAEL GAMBON, 88 (= Professor Dumbledore bei „Harry Potter“), sabbert nur herum; „Oscar“-Preisträger JIM BROADBENT („Iris“), der am 24. Mai „gerade mal“ 70 wird, ist dauerhaft grantig-eklig; Sir TOM COURTENAY, 81, unvergessen: „Die Einsamkeit des Langstreckenläufers“/1962, zuletzt in „45 Years“ bei der Berlinale von 2015 mit dem „Silbernen Darsteller-Bären“ belobigt, artikuliert sich hier reichlich schwammig; RAY WINSTONE, 61, seit Ewigzeiten prädestiniert auf brutale Gangster-Parts („Sexy Beast“; „London Boulevard“), schwadroniert nur blöd und mackerhaft herum. Fünf Asse und: Nix. Zu mögen; zu fassen; zu empfinden.
Lauter tolle Akteure in einem missmutigen, missgelaunten, missratenen, miserablen Film. „Ein letzter Job“ ist ein Rundum-Missverständnis (= 1 PÖNI).