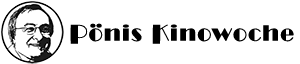PÖNIs: (3/5)
„DER UNSICHTBARE“ von Leigh Whannell (B + R; nach Motiven des gleichn. Romans von H. G. Wells/1897; USA/Australien 2019; K: Stefan Duscio; M: Benjamin Wallfisch; 124 Minuten; deutscher Kinostart: 27.02.2020).
Gastkritik von Dr. Rolf Giesen
Der mitunter krampfhafte Versuch amerikanischer Majors, alte Franchises der 1930er bis 1960er Jahre aufzupolieren und auf Blockbuster-Format hochzuladen, von „Superman“ über „Spider-Man“ bis zu den „Fantastischen Vier“ rauf und runter, hat auch die Universal auf die Idee gebracht, ihre Leichen aus dem Keller zu holen, einmal mehr ihr klassisches Gruselpaket zu öffnen und „Dracula“ plus „Van Helsing“, „Frankenstein“ und „Wolf Man“ auf neuerliche Geschäftsreise durch die Multiplexe zu schicken, doch die Rechnung hatten die US-Filmleute ohne den Wirt, sprich: den Filmzuschauer gemacht. Im Januar 2019 stoppte Universal die Dark Universe-Reihe, nachdem zuvor eine Neuauflage der „Mumie“ mit Scientology-Star Tom Cruise 2017 gefloppt war (s. Kino-KRITIK). Aber von Einzelbeiträgen, in die man schon investiert hat, will man dennoch nicht lassen. Irgendwie muss es ja weitergehen. Ein Remake des „Invisible Man“ war bei Universal immerhin seit 2007 in Vorbereitung. Der Bat- und Superman-erfahrene David S. Goyer hatte bis 2011 daran gearbeitet, mit einem Hollywood-Budget im Kopf. 2016 kam mit Ed Solomon („Men in Black“; „Die Unfassbaren“) ein neuer Autor an Bord, der eine Semi-Comedy für einen unsichtbaren Johnny Depp schreiben sollte, aber dann wurde der Geldhahn notgedrungen zugedreht und auf einen billigeren Gaul umgesattelt. Es wurde in Australien gedreht, und der Etat war nach amerikanischer Rechnung absolutes low budget: gerade mal sieben Millionen US-Dollar, koproduziert von Jason Blums Blumhouse Productions („The Purge“; „Split“; „Glass“).
Der Roman um eine moderne „Tarnkappe“, eine Formel, die unsichtbar macht und die ein junger Chemiker namens Griffin erfunden hat, war eine scientific romance des englischen Schriftstellers H. G. Wells, war 1897 erschienen und von der Universal (und Regisseur James Whale) 1933 mit Claude Rains zum ersten Mal kongenial verfilmt worden. Nur mehr das Motiv dient als Grundlage der neuen Filmversion von Leigh Whannell, eines durch Titel wie „Saw“ (s. Kino-KRITIK) und „Insidious“ als Fachmann für Gruselstoffe ausgewiesenen Australiers. Somit ist das Projekt kein Remake im eigentlichen Sinn. Um es vorwegzunehmen: von Griffin ist nur der Name geblieben, und der neue megalomane (Adrian) Griffin strebt auch nicht unbedingt nach der Weltherrschaft. Er nutzt die Erfindung der Unsichtbarkeit, die seinen Geist umnachtet, nicht für Zwecke, die eines Bond-Schurken und damit eines hohen Filmbudgets würdig wären, sondern um sich in den Niederungen eines Stalkers zu bewegen. Und da er überwiegend unsichtbar ist und sowieso nur eine Nebenrolle, hat man den Part mit einem Schauspieler aus der zweiten Reihe besetzt, mit OLIVER JACKSON-COHEN, der 2013 in der NBC-Serie „Dracula“ den Jonathan Harker gespielt und 2018 in der Web-Television-Reihe „The Haunting of Hill House“ zu sehen war. Denn der Fokus dieses Films liegt nicht auf Griffin, sondern auf seiner Lebensgefährtin Cecilia. Die hält es einfach nicht mehr mit dem Kerl aus. Sie verlässt den gewalttätigen Milliardär und Erfinder und flieht kopfüber in die Nacht aus der hypermodernen Villa des Kontrollfreaks. (Das erinnert ein wenig an „Der Feind in meinem Bett“ mit Julia Roberts.) Ihre Schwester bringt sie bei ihrem afroamerikanischen Jugendfreund und seiner Tochter unter, wo sie von einer Millionen-Erbschaft überrascht wird, die Griffin, der sich inzwischen aus Gram über den Verlust umgebracht hat, ihr über die Rechtanwaltskanzlei seines Bruders vermacht. Was sich nun abspielt, ist die paranoide Geschichte einer jungen Frau, die selbst glaubt, dass ihr ehemaliger Lover nicht tot ist, sondern sie wie ein unsichtbarer Harvey Weinstein verfolgt und drangsaliert, aber der wiederum kein anderer glaubt und die man alsbald für verrückt hält. Als sie sich in einem Restaurant ihrer Schwester anvertraut, kippt die plötzlich mit durchschnittener Kehle aus den Latschen, während #MeToo-Cecilia, die nicht weiß, wie ihr geschieht, urplötzlich ein blutverschmiertes Küchenmesser in der Hand hält. Und natürlich schwören alle Stein und Bein, dass sie die Mörderin ist.
Wer erwartet hat, dieser „Unsichtbare“ werde eine VFX (Visual Effects)-Orgie wie etwa Paul Verhoevens „Hollow Man“ aus dem Jahr 2000, sieht sich angenehm enttäuscht. Natürlich gibt es optische und physische Effekte, die etwa den unsichtbaren Stalker im Regen zeigen oder wie er Cecilia stranguliert, aber die sind sparsam (kein Wunder bei dem geringen Budget) und um der Story willen und nicht selbstzweckhaft eingesetzt. Whannell: „Ich habe da eine Möglichkeit gesehen, die Perspektive der Leute, was den unsichtbaren Mann angeht, zu wechseln. Es ist ja eine sehr bekannte Figur, aber sie ist im Lauf der Zeit eher Comedy geworden, wissen Sie, mit der schwebenden Sonnenbrille und den Bandagen.“ Die Perspektive aus der Sicht des Opfers macht Whannells Film sogar modern. ELISABETH MOSS verkörpert die Cecilia mit der Energie einer feministischen Aktivistin, die im Wettkampf steht mit männlichem Chauvinismus und sich keinen Augenblick weiblicher Schönheit gönnt. Aus der Ferne erinnert sie ein wenig an ihr Idol Bette Davis, aber wirklich nur aus der Ferne. Die Frau spielt sich die Seele aus dem Leib in dieser körperlich extrem anstrengenden, fordernden Rolle. Sie arbeitet sich an der Rolle ab, bis ihr der sprichwörtliche Schweiß auf der Stirn steht – aber es kommt nicht aus ihr. Sie ist nicht Cecilia, sie spielt sie nur. Man empfindet als Zuschauer nicht mit der Rolle, sondern, wenn überhaupt, mit den Qualen einer Schauspielerin, die sich vor der Kamera regelrecht abstrampelt und abrackert. Und deshalb geht man eher auf Distanz zu ihr. Richtig einlassen mag man sich auf den Film und die Figur nicht. Diese Cecilia ist eher abstoßend. Entertainment geht anders. Man muss schon ein wenig masochistisch veranlagt sein, um diese Art der Darstellung gut zu finden. ELISABETH MOSS gilt im realen Leben übrigens auch als Feministin – und nicht nur das. Wie Tom Cruise, der Universals Dark Universe-Konzept zu Fall brachte, bekennt auch sie sich zu Scientology.
Ein Handikap ist auch, dass die Bedrohung durch den Unsichtbaren keinen dramaturgischen Unterbau hat. Eigentlich erfahren wir nichts über diesen Adrian Griffin, außer dass er zu Gewalttätigkeit neigt und sich ein Kind von Cecilia wünscht. Das macht ihn letztlich uninteressant. Ob Angelina Jolie da noch, wie annonciert, als „Frankensteins Braut“ zu sehen sein wird, steht nach diesem Beitrag natürlich in den Sternen… (= 3 „Rolf Giesen“-PÖNIs).