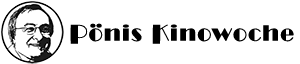PÖNIs: (4/5)
„1917“ von Sam Mendes (Co-B + R; GB 2019; Co-B: Krysty Wilson-Cairns; K: Roger Deakins; M: Thomas Newman; 110 Minuten; deutscher Kino-Start: 16.01.2020).
Gastkritik von Dr. Rolf Giesen
6. April 1917. Eine fiktive Episode aus dem Ersten Weltkrieg, beiläufig und doch über große Strecken ergreifend: Zwei englische Soldaten, Schofield (GEORGE MacKAY) und Blake (DEAN-CHARLES CHAPMAN, bekannt aus Game of Thrones), erhalten den Auftrag, einer Einheit von 1600 Kameraden, die tief in Feindesland liegt, eine wichtige Nachricht zu überbringen. Wenn sie angreifen, laufen sie in eine Falle und geraten in einen Hinterhalt der Deutschen. Ein furchtbares Gemetzel droht. Vom Erfolg der Mission der beiden Meldegänger hängt nicht nur das Leben der 1600 ab, es ist auch eine sehr persönliche Sache: In der Einheit dient Blakes Bruder.
Das ist einfach erzählt, aber komplex gefilmt. Regisseur Sam Mendes will mit diesem Film auch an seinen Großvater, einen Weltkriegsteilnehmer, erinnern, der mit 17 eingezogen wurde: „Er war von 1916 bis 1918 im Krieg. Über Jahre hat er niemandem erzählt, was damals passiert ist. Irgendwann öffnete er sich seinen Enkeln.“ Angeblich waren es keine Heldengeschichten, die er erzählte, sondern Geschichten vom Sterben und wie er als junger Mensch dem Tod entkam, während Kameraden neben ihm verbluteten. Diese existenzialistische Erfahrung hat Mendes in einem Film beschreiben wollen. Und dem Trend der Moderne zur Authentizität folgend, wie es im letzten Jahr schon Peter Jackson mit nachkoloriertem und vertontem Originalmaterial aus dem Weltkrieg in They Shall Not Grow Old getan hat, hat sich Mendes entschlossen, das fast Unmögliche zu wagen und den Plot in Echtzeit wiederzugeben: „Die Idee war von Anfang an, diese Geschichte über zwei Stunden scheinbar ohne Schnitt zu erzählen, um zu spüren, wie die Zeit vergeht, Sekunde für Sekunde. Wir wollten das Publikum so nah wie möglich am Geschehen teilhaben lassen.“ Es ist die ultimative Bild-Authentizität, die den Zuschauer involviert wie ein interaktives Spiel. Schofield und Blake werden zu visuellen Schachfiguren inmitten eines abscheulichen Gemetzels.
Roger Deakins, Mendes‘ Director of Photography, nahm die Herausforderung an, die ganze Geschichte so zu drehen, dass er die Illusion eines ununterbrochen lebensgefährlichen Meldegangs durch die Todeszone vermittelt, auf dass es ausschaut, als sei er in einer einzigen, fortlaufenden Einstellung gedreht. In Deutschland haben das ja bereits Sebastian Schipper und der norwegische Kameramann Sturla Brandt Grøvlen 2015 in Victoria (s. Kino-KRITIK), der Geschichte eines Bankraubs, mit einigem Erfolg probiert, nur ist das Mendes-Unternehmen, allein des Sujets wegen, ungleich aufwändiger. Die choreographische und technische Leistung ist ungeheuer, ganz ohne Frage. Eine dem Film entsprechende Ausführung der Film-Sets und drei leichtgewichtige, kompakte Alexa Mini LF Digitalkameras mit Large-Format-Sensor in Kombination mit Signature-Prime-Objektiven und dem Trinity-Stabilisierungssystem, alles komplett von ARRI, garantierten die Durchführbarkeit des Projekts. Deakins: „Das Bild, das die Mini LF in Verbindung mit den Signature Primes liefert, kommt dem, was meine Augen sehen, näher als alles andere, womit ich bisher arbeitete.“ Interessanterweise wurde ARRI Arnold & Richter im Jahr 1917 in München gegründet, und ohne die im Zweiten Weltkrieg von Kriegsberichterstattern eingesetzten Arriflex-Kameras wäre das von der Nouvelle Vague eingeleitete moderne Filmemachen unmöglich, hätte es weder Truffaut noch Fassbinder gegeben. Beide, Mendes und Deakins, hatten schon beim Bond-Abenteuer Skyfall zusammengearbeitet, aber die Leistung hier übertrifft bei weitem, was man bisher für möglich gehalten hat, und setzt neue kinematographische Maßstäbe auf der Leinwand. Gedreht wurde in Takes von acht, neun, zehn, elf Minuten Länge, aber für das Auge des Zuschauers gibt es nur einen wirklich sichtbaren Cut in diesem „Augenzeugenbericht aus dem Niemandsland“. Man spürt nicht nur den Krieg auf der Leinwand, man spürt auch den Krieg des Filmemachens: „Du drehst, sagen wir, einen achtminütigen Take in einem Rutsch. Sieben Minuten voller Magie sind bereits geschafft, und dann lässt jemand eine Requisite fallen oder der Kameramann stolpert. Dann musst du wieder von vorne anfangen, und nichts dieser sieben Minuten Magie ist verwendbar.“ Es sei, meint Mendes, ein Hin und Her zwischen Hoffnung und Verzweiflung gewesen.
Auch der Zuschauer selbst schwankt – zwischen Horror angesichts des filmischen Naturalismus der martialischen Apokalypse und dem Erstaunen über die Logistik der Filmemacher: Dreck, Schlamm, Pferdekadaver, von Granatsplittern, zerfetzte Leichen, alles rollt dynamisch in einem Rutsch am Auge des Betrachters vorbei. Es ist das schmutzige Gesicht des Krieges, das Mendes darstellt, und gleichzeitig der Beweis seiner Virtuosität als Filmemacher. Das ist menschlich ehrlich und technisch berechnend zugleich. Man kann nicht anders, noch während man den Film sieht, will man ihn einreihen in die Liste bedeutender Antikriegsfilme, Filme, die diesem hohen Anspruch auch wirklich gerecht werden: Im Westen nichts Neues (All Quiet on the Western Front) nach dem Roman von Erich Maria Remarque, gegen dessen Aufführung Goebbels im Dezember 1930 in Berlin seinen Mob losließ, Die Brücke (1959) von Bernhard Wicki, ein Schwarzweiß-Film, der auch heute noch unter die Haut geht, oder Masaki Kobayashis dreiteiliges Filmepos Barfuß durch die Hölle (Ningen no jōken), entstanden zwischen 1959 und 1961, der das japanische Kriegsverbrechen in der Mandschurei darstellt und dessen deutsche Fassung Wicki überwachte. Allen drei Produktionen ist gemeinsam, dass sie beim Zuschauer einen fatalistischen Eindruck hinterlassen. Es sind wahrhaft menschliche Tragödien. Nicht eine Minute wird der Krieg verherrlicht. Das unterscheidet sie von Filmen, die für sich in Anspruch nehmen, Antikriegsfilme zu sein und es doch nicht sind.
Mendes‘ Film kippt im letzten Drittel: Ein Luftkampf, ein Deutscher wird abgeschossen, seine Maschine geht vor den Meldegängern zu Bruch. Die beiden wollen dem Schwerverletzten zu Hilfe kommen, der um Wasser bettelt, aber der Pilot sticht Blake heimtückisch nieder. Jetzt geht es nur noch darum, dass der zweite, Schofield, durchkommt, und hier schlägt der Antikriegsfilm, der nichts beschönigt, um in ein Heldenepos, auf den der Titel eines englischen Films mit Hardy Krüger passen würde: „Einer kam durch“ (The One That Got Away). Schofield, der, der 1917 durchkommt, ist der Held, wenn er dem geretteten Leutnant Blake die Nachricht vom Tod seines Bruders überbringt: Mission accomplished. Der Fatalismus scheint wie weggeblasen.
Manche Kritiken sprechen daher auch konsequent nicht von einem Anti-, sondern von einem „Kriegsfilm der Extraklasse“, nominiert bereits als Bester Action- oder Kriegsfilm. Er nimmt nicht Stellung gegen den Krieg. Er bebildert das Geschehen nur schonungslos: Director Sam Mendes even noted that viewers do not need to know anything about WWI to enjoy the film. – Man müsse nicht viel über den ersten Weltkrieg wissen, um an dem Film, ja, da steht enjoy – seine Freude zu haben.
Der Film versuche auf irgendeine Weise, den Opfern einer verlorenen Generation Tribut zu erweisen, lesen wir im Wikipedia-Eintrag. Auf irgendeine Weise klingt verdammt unbestimmt. Eine Hälfte dieser verlorenen Generation, die deutsche, hat in Mendes‘ Film so gut wie kein Gesicht, weil alles ja nur aus der Schrittperspektive der Meldegänger erzählt wird, ohne Schnitt auf die Gegenseite. Es sind nur ein paar deutsche Stahlhelme, die da in Jüngerschen „Stahlgewittern“ herumirren und kotzen; sie könnten auch Stormtroopers aus der Filmfabrik von Lucasfilm/Disney sein. „Ich will“, sagt Mendes, „dass die Leute verstehen, wie schwierig die Lage für die Männer war.“ Tatsächlich merkt der Zuschauer nur, wie schwierig die Lage für die Filmcrew war, die technische Schlacht der authentischen Bilder für sich zu entscheiden. Das visuelle Feuerwerk drückt die menschliche Tragödie schließlich in den Hintergrund. Der Bewunderung für die unerhörte filmische Leistung tut dies freilich keinen Abbruch (= 5 PÖNIs für Inszenierung und Kameratechnik; 3 PÖNIs für Inhalt = Mittelwert 4 PÖNIs).