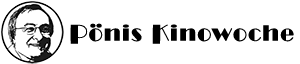Es ist bedauerlicherweise passiert: Dass ich einen sich im Bereich von 5 PÖNIs bewegenden Kinofilm beim deutschen Kinostart übergangen beziehungsweise damals nicht „geschafft“ habe zu sehen. Obwohl sich die internationale Kritik nach der Aufführung im Cannes-Wettbewerb von 2013 überaus wohlwollend (bis euphorisch) äußerte. Und obwohl der (heute 54jährige) Regisseur ALEXANDER PAYNE durch Filme wie „About Schmidt“ (2002/mit Jack Nicholson), „The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten“ ((2011/mit George Clooney), für den er die „Oscar“-Trophäe für das „Beste adaptierte Drehbuch“ erhielt, sowie über den mit insgesamt 34 Auszeichnungen hochdekorierten Debütfilm „Sideways“(2004), für den er ebenfalls den Drehbuch-„Oscar“ zugesprochen bekam, längst einen hervorragenden Namen besitzt. Umso wichtiger, dass er nun, nach der sechsfachen diesjährigen „Oscar“-Nominierung – anlässlich seiner Heimkino-Premiere – endlich vorgestellt werden kann:
Es ist bedauerlicherweise passiert: Dass ich einen sich im Bereich von 5 PÖNIs bewegenden Kinofilm beim deutschen Kinostart übergangen beziehungsweise damals nicht „geschafft“ habe zu sehen. Obwohl sich die internationale Kritik nach der Aufführung im Cannes-Wettbewerb von 2013 überaus wohlwollend (bis euphorisch) äußerte. Und obwohl der (heute 54jährige) Regisseur ALEXANDER PAYNE durch Filme wie „About Schmidt“ (2002/mit Jack Nicholson), „The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten“ ((2011/mit George Clooney), für den er die „Oscar“-Trophäe für das „Beste adaptierte Drehbuch“ erhielt, sowie über den mit insgesamt 34 Auszeichnungen hochdekorierten Debütfilm „Sideways“(2004), für den er ebenfalls den Drehbuch-„Oscar“ zugesprochen bekam, längst einen hervorragenden Namen besitzt. Umso wichtiger, dass er nun, nach der sechsfachen diesjährigen „Oscar“-Nominierung – anlässlich seiner Heimkino-Premiere – endlich vorgestellt werden kann:
„NEBRASKA“ von Alexander Payne (USA 2012/2013; B: Bob Nelson; K: Phedon Papamichael; M: Mark Orton; 115 Minuten; schwarz-weiß; deutscher Kinostart: 16.1.2014; Heimkino-Veröffentlichung: 30.05.2014).
Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass man den Hauptdarsteller dieses in Schwarz-Weiß gedrehten Movies überhaupt nicht (mehr) auf der, wie es heute so schön neudeutsch heißt, Agenda hatte: BRUCE DERN. Gewiss, der soeben, am 4. Juni 2014, 78 Jahre alt gewordene Veteran des amerikanischen Kinos, ist aus unzähligen Hollywood-Filmen Gesichts-bekannt. Aber ER war nie DER, der am Ende als „Held“ an vorderster Sympathie-Front davonzog oder „das Mädel“ abbekam, um das sich Filmkerle bekanntlich ständig abstrampeln. Im Gegenteil: Bruce Dern war oftmals auf „ziemlich üble Typen“ abonniert („Marnie“ von Alfred Hitchcock; „Wiegenlied für eine Leiche“ von Robert Aldrich/beide von 1964). In dem Western „Die Cowboys“ von Mark Rydell durfte er 1971 sogar DIE Hollywood- Western-Legende John Wayne erschießen. In meisterlichen Filmen wie „Nur Pferden gibt man den Gnadenschuß“ von Sydney Pollack (1969) und „Lautlos im Weltraum“ von Douglas Trumbull (1972), wo er als Astronaut ein intergalaktisches Gewächshaus gemeinsam mit zwei Robotern als letzten „Wald der Menschheit“ pflegte, etablierte sich der hochgewachsene Typ als markanter und profilierter Charakterdarsteller des New Hollywood-Kinos. Es gäbe noch viel zu sagen über diesen „unbekannten“ BRUCE DERN, der auch in Hitchcocks letztem Thriller „Familiengrab“ (1976) mitmischte und in bislang über 80 Filmen auftrat, doch dafür ein anderes Mal an anderer Stelle (gerne) mehr. Nur dies noch: Quentin Tarantino ist ein Fan von Bruce Dern und besetzte ihn in seinem Meisterwerk „Django Unchained“ für einen Kurzauftritt als – klar doch – sadistischen Sklavenhalter.
Hier aber gehört und ganz allein IHM die Show.
In „Nebraska“, woher auch Regisseur Alexander Payne stammt, mimt er den alten Woody Grant. DER bereitet seiner Umgebung nur Kummer. Als knarziger, knochiger Sturbold. Der immer noch, wie schon sein ganzes verdammtes Leben lang, zu viel säuft. Und nun darauf besteht, einen vermeintlichen Millionen-Gewinn von der Lotterie persönlich abzuholen. In Lincoln, Nebraska. Viele, sehr viele hunderte von Meilen von seinem Wohnort Billings in Montana entfernt. „Ich vertraue doch der Post keine Million Dollar an“, wischt er die Einwände seiner ewig keifenden Ehefrau Kate („Ich wusste gar nicht, dass du Millionär werden willst“) und seiner Söhne David und Ross ab. Notfalls zu Fuß. Will er dorthin. Um seiner offensichtlich verpfuschten Existenz wenigstens einen letzten Sinn zu geben. Und Lebensstempel aufzudrücken. Also nimmt sich schließlich David (WILL FORTE) eine berufliche Auszeit und macht sich mit seinem Vater auf den langen, natürlich beschwerlichen, aber auch lebens-abenteuerlichen Auto-Weg.
Alexander Payne erzählt vom tristen Blues der anderen Amerika-Straße. Wo keine unsäglich geschminkten Menschen aufgedonnert herumwuseln. Wo es nicht ständig „bunt“ nur darum geht, im täglichen kapitalistischen Konkurrenzkampf den eigenen profitablen Mehr-Wert zu erkämpfen. Sondern wo der eigenen Existenz längst die Farbe abhandengekommen ist. Wo Stimmungen wie „the American Dream“ oder „Aufbruch“ nie aufgetaucht sind. Vorhanden waren. Man lebt hier. So. In diesem „verwaschenen Grau“. Hat sich damit abgefunden. An diesen wunderlichen Jenseits-Orten Amerikas gestrandet zu sein. Payne versieht dies nicht als Anklage, sondern als Bestand. Motto: Wenn karge Landschaft (mit ihren leeren Straßen und Farmerhäusern) und „normale“ Menschengesichter (in jeder Falten- und Gewichtsordnung) eine lebhafte Provinz-Einheit bilden. Und in DIE nun dieser alte Kauz mit seinem (lange) „fassungslosen“ Sohn einbricht. Was zu „außergewöhnlichen Bewegungen“ führt. Denn wenn hier ein „richtiger Millionär“ auftaucht, stößt DAS schon auf allgemeines Provinz-Interesse. Und weckt auch „natürliche“ Begehrlichkeiten. Sowohl innerhalb der eigenen Sippe, die sich an Woodys Geburtsort (dem fiktiven schäbigen Hawthorne) versammelt, wie auch bei „guten Freunden“, die so gerne auch etwas vom großen Dollar-Kuchen abhaben wollen (darunter auch, in einer wunderbaren filmischen Endlich-Wiederbegegnung, der bullige STACY KEACH als fieser Kumpel Ed, mit sogar einem Karaoke-Auftritt). Während Sohn David mit seinen Argumenten, es gäbe gar keinen Gewinn, kaum Gehör findet. Man will glauben, dass Einer von Uns es tatsächlich doch geschafft hat. Eine Million Dollar zu haben. Besser: bald zu bekommen. Welch eine Abwechslung. In diesen dauer-tristen Ewig-Tagen. Hier. In denen Woody auch wieder gerne trinkt („Du würdest auch trinken, wenn du mit deiner Mutter verheiratet wärst“).
Ein Road Movie. In die Vergangenheit eines alten, gebrechlichen, verschlossenen Stänker-Zausels. Als dann auch sensibler Zukunftstrip für seinen ungeduldigen Sohn. Die eine Generation bäumt sich noch einmal auf, die andere beginnt – endlich – mehr zu verstehen. In Sachen Herkunft, Identität, Seelen-Sinn. Erklärungen für „Verhaltensstörungen“. Innerhalb der Familiengemeinschaft. Vielleicht sollten sich manche auf „solch einen Weg“ begeben, um zu sich zu finden. Lassen die ruhigen, spannungsgeladenen Bilder denken. „Nebraska“ sieht sich wie ein schwarz-weißer Peter Bogdanovich-Provinz-Klassiker aus den filmischen Siebzigern ebenso an („The Last Picture Show“) wie er auch an einen dieser unvergessenen Western aus Hollywood erinnert, in denen staubige, sture Pioniere sich aktiv daranmachten, das eigene Land zu erkunden, zu erobern, und dabei mit Legenden hantierten („Der Mann, der Liberty Valance erschoß“ von John Ford/1962). In der filmhistorischen Außen-Ansicht.
Im Innern blickt er nüchtern auf ein aktuelles bizarres Amerika-Out. Der alte Woody Grant ist kein Mythos. Und schon gar keine Legende. Sondern ein – mal mehr, mal weniger – sturer Alt-Bengel. BRUCE DERN als mürrischer, furchtlos die vielen Lebensjahre ausspielender Woody verwächst komplett wie furchtlos in diese hochbetagte Figur. Outlaw-Rolle. Mit seinen zerzausten weißen Haaren, dem humpelnden Gebrechlichkeitsgang, der demenzartigen Abwesenheit, dem beharrlichen, pfiffigen Lenken seines Willens und Wollens; angelegt zwischen lakonischem Trottel und tumben Weisen; mal als Pflegefall, mal als letzter Cowboy. Am Ende einer verkorksten Dienstzeit.
Mal tragisch, mal sanft komisch, aber nie verbissen oder stumpf: BRUCE DERN als Don Quichotte-Sturkopf aus dem amerikanischen Mittelwesten ist diese Film-Reise wert. In „Nebraska“ kann er seinen darstellerischen Olymp endlich erklimmen. Darf sein Potenzial endlich auf Genie-Höhe schrauben. Vorführen. Ist so etwas von wunderbar körpersprachlich-intensiv. Aus SICH heraus. Ohne viele Sätze dafür zu benötigen. Zu verbrauchen. Er steht einfach da und IST faszinierend–präsent und verständnisvoll- ergreifend dieser Woody Grant. Mit aller Wahrhaftigkeit, die ein Schauspieler „äußern“ kann. Aus sich „herauszuholen“ vermag. In Cannes bekam er im Vorjahr den Preis für den „Besten Darsteller“. Die diesjährige „Oscar“-Nominierung adelte zu Recht diese imposante, einfühlsame Hochleistung.
Aber auch das Ensemble ist einfach „immens“. Bewegt sich dezent -klar und charismatisch als glaubhaftes gesellschaftliches Refugium. Diese herrliche Ballade „NEBRASKA“, Budget: 13 Millionen Dollar, zählt zu DEN US-Filmen, die man gesehen haben MUSS. Um KINO im Ursprung zu begreifen (mit richtigen Geschichten und ebensolchen Menschen); und um KINO wieder einmal – und hier: in sagenhaft atmosphärischem, prächtigen Unterhaltungs-Schwarz-Weiß – in sich genüsslich aufnehmen zu können.
„Nebraska“ ist ein besonderer Film (= 4 1/2 PÖNIs).
Anbieter: „Paramount Pictures Home Entertainment“