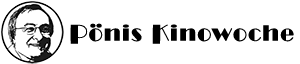|
„MANDELA: DER LANGE WEG ZUR FREIHEIT“ von Justin Chadwick (GB/Südafrika 2012/2013; B: William Nicholson, basierend auf dem Buch „“Long Walk To Freedom“ von Nelson Mandela/1994; K: Lol Crawley; M: Alex HeffesSong: „Ordinary Love“ von U2; 152 Minuten; Start D: 30.01.2014); es ist unstrittig, dass NELSON MANDELA – 18. Juli 1918 – 5. Dezember 2013 – eine überragende Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts war. Der Friedensnobelpreisträger (1993) und erste Schwarze Präsident Südafrikas ist „eine Ikone, auf die sich alle Lager verständigen können“ („epd Film“/2 2014“). Ihm in seiner wahren Person auch nur annähernd nahe zu kommen, wird der Spielfilm nicht gerecht. Er gibt sich (merkbare) Mühe, die vielen privaten wie politischen Stationen seines Lebens Revue passieren zu lassen, verheddert sich dabei aber ständig im permanenten Vorzeigen von Massenszenen als läppische Dauer-Erklärung für engagierte Aktivitäten – SO WAR ES beziehungsweise DAS WAR ER. Nelson Mandela. Er bekommt in diesem langen Spielfilm zwar den ihm gebührenden Respekt, aber keine wirkliche Energie und Spannung. Und Identität. Diese bleibt hier immer nur Behauptung. Und deshalb langweilt der Spielfilm zunehmend. Was angesichts dieses außergewöhnlichen Menschen, dieser bedeutsamen historischen Person und seiner immensen Bedeutung und „Wirkung“ im vergangenen Jahrhundert, ein unangenehmes Schamgefühl auslöst: Man möchte ihn „spüren“, fühlen, ihn nachempfinden, entdecken, ausloten. Deutlich kennenlernen. Deutlicher. Seine gesellschaftliche, also politische Kraft emotional wie intellektuell greifbar „haben“. Nichts da. Der Film hakt mit sehr viel Gebrüll, über kurze episodenhafte Geplänkel und zeitlichen Motiven die Daten, Fakten, Zustände ab. Ebenso unverbindlich wie mitunter visuell gekonnt- explosiv. Frei nach dem alten TV-Motto: Das war Ihr leben, Nelson Mandela! Da haben Sie dies gemacht, dort passierte jenes. Hier haben sie studiert, dort sich verliebt. Hier erlangten sie angesichts der widerlichen Apartheid politisches Bewusstsein, dort haben sie sich dann engagiert. Hier begannen sie sich zur politischen Rebellen- und Gallionsfigur zu entwickeln, dort ergaben sich familiäre Spannungen. Hier begannen die Aktionen, dort die brutalen Folgen. Hier wird ihnen der Prozess gemacht, dort sind sie über viele Jahre eingesperrt. Im Gefängnis. Auf Robben Island. Hier werden sie schikaniert, in Einzelhaft verwahrt, dort beginnt man Gespräche. Nach 27 Jahren die Freiheit. Hier ihre Bemühungen, Frieden statt Rache auszurufen, dort ihre Präsidentschaft. Mit der Botschaft zur Versöhnung. So zieht sich der Film hin und durch. Schön, aber reizlos anzuschauen. Mit Wirkungsfaktor „weiß nicht“. Nelson Mandela mal hier, mal da, immer inmitten von „Massen“, selten und dann kurz allein. In Momentaufnahmen: Die Frauen, die bitteren Auseinandersetzungen des weisen alten Mannes mit seiner verhärteten, radikalisierten Ehefrau Winnie (NAOMI HARRIS). Immer nur punktuelle Blicke, aber kein spannender Druck, sich mit „seinem“ Gesehenen tatsächlich zu befassen. Es anders als „statistisch“ aufzunehmen. Nur abzuhaken. Der Film ist eine aufwändige Abfolge von Mandelas Leben, besitzt aber keine Seele. Man bleibt hier „neutral“. Wut ist nur Ansage. Über Umgebung, Verletzungen, Ungerechtigkeiten. Die Schande der Apartheid. Diese elende Gewalt. Der blanke „vergnügliche“ Sadismus. Der Weißen. Als „Argument“. Auf der politischen Seite. Ebenso wie die individuellen Gefühle: Zweifel, Entsetzen, Ratlosigkeit, Empörung, Druck. Über Erniedrigung, Entmenschlichung, Grausamkeit. Vieles wird gesagt, gezeigt, bleibt aber „im Rahmen“. Von eben Behauptung. Ohne innere Füllung. Man bildert viel auf. Und ab. Als Pflicht“lektüre“. Programm-Auftrag. Stakkatobrav. Bemüht. Ohne schärfere Konturen. Mit der risikolosen Vorsicht, im Unterhaltungskino ja nichts wirklich „anbrennen“ zu lassen. Ich zeige breit, also tippe ich nur an: Der britische Regisseur JUSTIN CHADWICK, 45, einst als Schauspieler unterwegs („London Kills“), auf der Berlinale von 2008 mit seinem Historiendrama „Die Schwester der Königin“ im Wettbewerb vertreten, vermag mit „Mandela: Der lange Weg zur Freiheit“, wenig zu bewirken. Und das bei DIESEM gewichtigen Thema, und DIES bei dieser imponierenden, einzigartigen Person/Persönlichkeit. Bei diesem gewichtigen Staats-Mann. Den IDRIS ELBA, über einen Zeitraum von über 50 Lebensjahren / von 23 bis 76, nur bemüht und schwer „packt“. Mehr als Maske denn als Mensch. Sein Mandela verstreut kein Charisma, sondern wirkt wie ein seelisches Kalenderblatt. Ein abgearbeitetes Leben. Mit vielen gebündelten Fußnoten. Privatem Scharmützel. Widerstandsaktionen. Und eben immer wieder, als filmisch harmloser Ausdruck, als stetes biographisches „Argument“: „Erfolgreiche“, aber letztlich nur nervende aufgeregte Massenaufläufe. Zunehmend völlig ins Leere abdriftend. Wie gespielte Wochenschauaufnahmen. Idris Elba, zuletzt als Asens-Gotts Heimdall in der Comic-Adaption „Thor – The Dark Kingdom“ auftauchend, gibt sich furiose Mühe, Mandela gerecht zu werden, aber diese Anstrengung ist viel zu auffällig. Zu (be-)merken. Auffällig. Äußerlich wie innerlich. Er spielt Nelson Mandela nach, „ist“ aber nicht der große Mann. Bürger. Anführer. Wirklich. Ist nicht spürbar. Vermittelbar. Auffindbar. Eine Fehlbesetzung. Spitz formuliert: Da lösen die Einspielungen von Originalaufnahmen (von Nelson Mandela himself oder zum Beispiel vom 1988er „Free-Mandela-Konzert“ im Londoner Wembley-Stadion) weitaus mehr „Gänsehaut“ aus als es der überlange Film jemals auch nur ansatzweise vermag. Der Film „Mandela: Der lange Weg zur Freiheit“: Absicht gut, Ausführung weniger. Weit weniger (= 2 PÖNIs). |
|||
x