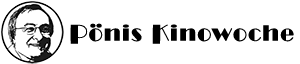Protokoll eines Films„KOPFSTAND“ von Ernst Josef Lauscher (B + R; Österreich 1981; 112 Minuten; Start D: 1983). Die Handlung des Films beruht auf Tatsachen. In einer Spielhalle. Ein Junge interessiert sich für ein Mädchen, die dort als Kassiererin arbeitet. Er hat Hemmungen, sie anzusprechen. Wartet abends nach Feierabend vor der Tür, um sie nach Hause zu bringen. Sie ist der aktivere Teil, hat Interesse an den Jungen, und man verabredet sich für den nächsten Tag. Zu Hause bei Markus. Die Mutter nörgelt herum. „Anständige Menschen liegen um die Zeit im Bett“. Man fängt an zu streiten. „Im Haus reden’s schon über uns“, argumentiert Frau Dorn. Und: „Schau dich doch mal an, wie du daherkommst. Als wenn du irgendwo entsprungen wirst“. „Freilich“, stichelt Markus zurück. Dann beschuldigt sie ihn, Rauschgift zu nehmen. So einer wie er…, das liegt doch auf der Hand, das sieht doch jeder. Sagt die Mama nicht, aber meint sie. Markus wird sauer, bockig. „Du spinnst ja total“. Und „räumt“ dann den Tisch ab. Es kommt zu einem kleinen Handgemenge. „Der ist ja verrückt“, äußert sich der hinzukommende Freund der Mutter, der auch in der kleinen Behausung wohnt. Schnitt. Markus liegt im Bett. Die Polizei kommt. Die Mutter hat tatsächlich die Polizei geholt. Ihrem Freund, Herrn Hubert, scheint das gar nicht so unlieb, ist doch die Wohnung für drei sowieso zu eng. Vernehmung bei der Obrigkeit. Es hat überhaupt keinen Sinn, dass du bockig wirst, will man es sich bequem machen. Je schneller dir was einfällt, umso schneller kannst du wieder gehen, versucht man ihn zu locken. Der Beamte will Namen. woher das Rauschgift stammt? Wer sonst noch „daran“ beteiligt ist? Und so weiter, und so weiter. ‚Freundliches Entgegenkommen‘ würde man schon honorieren, wird staatlicherseits signalisiert. „Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen“, klingt es trotzig zurück. Was den Amtspersonen natürlich überhaupt nicht gefällt, bedeutet das doch Mehrarbeit bei diesem klaren Fall. LSD, Heroin, mit irgend sowas muss doch einer wie er zu tun haben, werden sie energischer. Dabei frage ich mich die ganze Zeit, wieso die ihn so piesacken. Der Junge trägt lange Haare, hat eine Lederjacke an, aber die Zeiten, wo dies schon ‚Gefahr‘ für Bürger und Staat bedeutete, sind doch nun wirklich vorüber, oder? Markus sieht so normal aus wie viele in seinem Alter heutzutage. Vielleicht ein bisschen blasser, aber sonst…? 1981 spielt der Film. Markus versucht klarzumachen, dass das mit dem Rauschgift nur so eine fixe Idee von der Mutter war. Natürlich glauben die ihm nicht. Tätlicher Angriff gegen die Mutter, Einschränken der persönlichen Freiheit, das ist Gemeingefährlichkeit, stellt schließlich der Oberpolizist fest. Aber bitte – „sobald du uns ein paar Namen sagst, kriegst du eine Chance“, wird noch einmal gut zugeredet. Aber Markus hat nichts zu sagen. Oder doch „Der Eine heißt John Lennon“. Überführung in eine Klinik, genauer: in eine psychiatrische Anstalt, die Klapsmühle. Schwarz-weiße lange Gänge mit kahlen weißen Wanden, Gittern an den hohen Fenstern und desinteressierten, missmutigem Personal. Ab und an Brüllen hinter den geschlossenen Türen. Alles hier ist so düster, so deprimierend. Ich denke, wer hier rein- kommt und nicht ganz fertig ist, hier wird er’s bestimmt. Wenn einer aufmuckt, kommt sofort der Chefarzt mit der Spritze. Und schon ist die Ruhe, die Ordnung wieder hergestellt. Mir kommen ketzerische Gedanken bei den vielen Spritzen. Wie wäre es wenn unsere Obrigkeit überall Spritzen, solche Spritzen parat hätte. Für eine bestimmte beamtete Auslese. Die sollte befugt sein, immer spritzen zu dürfen, wenn es irgendwo zu laut wird. Wir hätten den ruhigsten Staat der Welt. Und die Politiker könnten endlich in Ruhe und Abgeschiedenheit ihre Politik machen, und die Polizisten bräuchten sich nicht mehr so abzuhetzen bei Demos, und die Beamten in den Stuben könnten mit aller gebotenen Muße und Pflicht walten und verwalten, ohne dass sie von irgendwelchen Der Junge freundet sich mit zwei Bettnachbarn an. Die sind hier, weil sie draußen nicht mehr zurechtkamen, sich wundgescheuert haben am Alltag. Und dann ist da noch Karl, der Alte. „Ich bin zu alt für draußen“. Der hat längst aufgegeben. Mit dem hat niemand Schwierigkeiten mehr. „Depressionen?“, fragt der Oberheiler bei der Visite? Die hat doch jeder. Sie nicht, gibt Markus von sich. Für Dr. Melzer steht damit fest – der ist gemeingefährlich, schizophren. Vor so einem muss die Welt beschützt werden. „Ich will nach Hause, mir fehlt nichts“, fordert der Junge nochmals nachdrücklich. Den Ton kannst du dir hier gleich abschminken, tönt es hilfreich retour. Und der Pfleger ergänzt höflich: „Du Arschloch. Ich mach aus dir eine Nummer, damit wir schauen, dass aus dir wieder ein Mensch wird“. Nummern sind also gefragt. Mir fällt „Einer flog über dem Kuckucksnest“ ein. Aber da gab’s einen Jack Nicholson, und der war ein irrer Held. Christoph Waltz ist kein Held. Der ist bloß ein österreichischer Junge namens Markus. Den sie jetzt mit Elektroschocks behandeln. Drähte, Eisenmetallstäbe werden fest am Kopf angebracht und ab geht der freundliche Strom durch den Körper. Soll ja gesund sein. Und Markus hüpft vor Freude über so viel Volt im Bett auf und ab. Die Mutter kommt zu Besuch. Um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, hat sie sich eingeredet, dies hier sei so etwas wie ein Fitness-Center für die Konditionierung zu anständiger Bürgerlichkeit. So was wie Bundeswehr, wenn man gesund ist. Und der Arzt-Oberst gibt ihr sogleich Recht. Markus sei nach wie vor renitent, störe Gerichtskommission. Genauso wie das klingt, sieht sie auch aus. Lauter bekannte, anonyme Kommissionäre. „Ich hab‘ doch nix“, darf sich der Junge äußern. Und hat damit ganz klar deutlich gemacht, dass er nicht ganz bei Verstand ist. Markus haut ab. Ein Freund hilft mit etwas Geld weiter, bei dem Mädchen aus der Spielhalle kommt er für eine Nacht unter, dann sorgt ihr Freund am nächsten Morgen dafür, dass sie den Jungen wieder kriegen. .An dieser Stelle etwas zum Heutzutage hat man die Methoden allerdings verfeinert. Was für Markus neue Elektrobehandlungen bedeutet, die ihn immer apathischer werden lassen. Dennoch schafft er es nochmal abzuhauen. Diesmal gelangt er sogar bis zur Mutter. Er bittet um Hilfe, Beistand, Verständnis, aber sie macht sich Sorgen um die Gedanken der Nachbarn. Zudem hat Freund Hubert ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Paranoia, lautet nunmehr die Diagnose, nachdem der Junge in die Anstalt zurückgebracht wurde. Wo sich eine neue Ärztin für ihn interessiert. Sie macht ihm klar, dass er entmündigt wurde. „Du bist rechtlich jetzt einem Kind von sechs Jahren gleichgestellt“. Frau Dr. Rene aber lässt es damit nicht auf sich beruhen. Sie kümmert sich eingehend um die medizinische wie private Geschichte von Markus Dorn. Sie spricht viel mit ihm, und sie nimmt auch Kontakt mit der Mutter auf. Dass der Junge dann tatsächlich rauskommt, ist vor allem ihr zu verdanken. Happy End? Friede, Freude, Eierkuchen? Die weiterhin schlichten, strengen Schwarz-Weiß–Bilder weisen diese Vermutung sofort von sich. Regisseur Lauscher bleibt stringent bei seinem Film. Fügt ihm weitere Handlungsstränge zu. Denn für Dr. Rene war es nicht nur wichtig, den Jungen wieder für den „normalen“ Alltag herauszubekommen, sie hilft ihm im Hintergrund auch weiter. Weil der Junge Hilfe braucht. Er ist kräftemäßig am Ende, bricht oftmals „einfach so“ zusammen, ist im Augenblick zu keiner geregelten Arbeit mehr fähig. Schon gar nicht in seiner Lehre als Friseur. „Albert – warum?“ fällt mir ein. So wie der Albert aus Niederbayern aus dem Josef-Rödel-Film, so ähnlich staksig und „schwierig“ bewegt sich jetzt auch der Markus aus Wien. Die Ärztin vermittelt ihm die Begegnung mit einer älteren Frau, die irgendwo außerhalb alleine in einem großen Haus wohnt. „Ich brauche nichts mehr“, wehrt die sich anfangs. Um dann doch ein bisschen zufrieden zu sein, dass sie endlich einmal mit jemandem reden kann. Und manchmal sogar auch lachen: „Merkwürdiges Gefühl. Als wenn man es wieder lernen müsste“ Der Regisseur und Autor Ernst Josef Lauscher: „Dass er schließlich auf einen Menschen trifft, sich ihn fast zum Ziel nimmt, der alt und einsam ist, ist kein Zufall. Denn wie kaum anderswo haben wir auch unsere Alten verstört, weggeschoben, verdrängt. Mehr als irgendeine andere Beziehung gibt Markus‘ Freundschaft mit der alten Dame ihm den Mut zurück, den er fast verloren hatte“. Es ist kein Zufall, dass einem laufend die Anfänge der französischen „Neuen Welle“ Anfang der Sechziger in Erinnerung kommen. „Kopfstand“ hat etwas mit Godard, Truffaut, Rohmer zu tun. Das karge, freudlose schwarz-Weiß, die kurzen, knappen Dialoge, die Sprache des Dazwischen, der Blicke, der Bewegungen, der Mimik; keine aufdringliche Musik, um die Emotionen in eine ganz bestimmte Mitleidsecke zu drängen; die interessanten, neuen, unbekannten Gesichter der Beteiligten – das ist Kino, das wieder Hoffnung macht. Weil es von Menschen erzählt und nicht von Dingen. Weil es zugleich spannend ist und betroffen macht. Der 35-jährige Wiener Filmemacher Ernst Josef Lauscher zu seiner ersten Spielfilmarbeit: „Man kann sehr vieles über eine Gesellschaft erfahren, wenn man sieht, wie sie mit Ihren Kranken, mit ihren Gestörten, mit ihren Außenseitern umgeht. Die beste Lösung in ihrem Sinne scheint zu sein, das Problem zu verdrängen, die Betroffenen wegzusperren, weg aus dem Blickpunkt einer breiteren Öffentlichkeit, die auch zu bequem Ich finde, dieser Film hat sehr viel mit Berlin-West 1983 zu tun (= 4 PÖNIs). |
|||