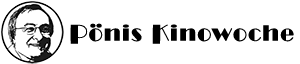„KLEINE FLUCHTEN“ von Yves Yersin (Co-B+R; Schweiz 1977-1979; 138 Minuten; Start D: 15.02.1980)
„KLEINE FLUCHTEN“ von Yves Yersin (Co-B+R; Schweiz 1977-1979; 138 Minuten; Start D: 15.02.1980)
Wohl selten zuvor hat der Film eines Schweizers eine so überwältigend positive Resonanz bei den Kritikern in seinem Land gefunden wie „Les petites fugues“. Und das will in der Heimat der Tanner, Goretta oder Soutter schon etwas heißen. Stellvertretend für die allenthalben einmütige Anerkennung sei die „Neue Zürcher Zeitung“ zitiert, die ihre Kritik mit dem Satz einleitete: „Nun hat der neue Schweizer Film sein Meisterwerk erhalten“. Nun, es ist abzusehen, dass der Film auch hierzulande Kritiker zu Jubelstimmen veranlassen wird, ebenso wie das Publikum. Ich bin sicher.
Eine leere Bahnstation. Inmitten einer wunderschönen Sonnenlandschaft. Auf dem Bahnsteig wartet, leicht nach vorne gebeugt und in starriger Pose, ein alter Mann auf den Zug. Als der kommt, steigt er nicht etwa ein, sondern holt sich etwas ab. Ein Moped. Sein Moped. Oder wie es in der französischen Sprache heißt: sein Töff. Von seinen ersten Rentengeldern hat sich Pipe, der Knecht, diesen fahrbaren Untersatz zugelegt.
Pipe. So nennen ihn alle auf dem Hof. Ein treuer Knecht, der seit 30 Jahren gegen bescheidenen Lohn und Logis mindere Arbeit verrichtet. Man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass er wortkarg und zumeist in sich gekehrt seine Arbeit verrichtet. Er gehört praktisch zum Inventar dieser kleinen, abgeschlossenen Welt, und dennoch gibt es niemanden, dem er je besonders aufgefallen ist. Ein Klotz ohne Seele, das ist er für die meisten. Deren Gemeinschaft sich wie ein am Auseinanderfallen begriffenes Familienleben darstellt (ohne dass diese es bisher bemerkt hätten). Da ist der alte Bauer, der sich dem Generationswechsel verschließt und halsstarrig, was für die anderen (und für ihn selbst) nach und nach zu einer unerträglichen Belastung werden wird. Der sich permanent jeder Diskussion verweigert, die sein Sohn Alain längst schon herbeiwünscht. Denn der Hof ist unrentabel geworden, bedarf der Modernisierung, also zunächst einmal der (vor allem finanziellen) Investition. Alain versteht es nicht, zwischen sich und seinem Vater sorgsam zu vermitteln, ist genauso ein leicht aufbrausender Charakter, und so geraten sie andauernd aneinander. Die fleißige, ehrsame Bäuerin hat Mühe, die immer häufiger aufkommenden Streitereien zu beruhigen. Tochter Josiane fühlt sich eingesperrt, sieht sich aber außerstande wegzugehen, weil sie ein uneheliches Kind zu versorgen hat und ihr die Eltern größtenteils das Kind „abnehmen“. Zur Gemeinschaft gehört ferner der italienische Gastarbeiter Luigi, zu dem schließlich Josiane flüchten wird, und eben – Pipe.
Der Film beginnt an dem Tag, an dem sich der Alte das Mofa abholt. Das er zunächst „pflegt und hegt“ wie ein Kind. Er stellt es in seinem kleinen Zimmer unter, aber der Sonntag kommt dann doch, wo es gilt, die ersten Versuche mit dem Töff zu wagen. Erst muss Luigi helfen, dann aber will Pipe es alleine schaffen. Er übt unermüdlich, und als er es schließlich kann und zum ersten Mal im Fahren ein rauschhaftes Freiheitsgefühl erlebt, da wechselt die Kamera die Perspektive, sieht plötzlich mit den Augen des Fahrers. Musik setzt ein und unverhofft beginnt die kleine, enge Straße unter ihm zurückzubleiben. Der Wald wird kleiner, der Blick schweift über die Weite der herrlichen Landschaft: Pipe hat abgehoben.
Allein diese im Grunde sehr riskante Einstellung wird Filmgeschichte machen, denn sie ist in technischer Umsetzung eine absolute Meisterleistung. Aber auch ansonsten nicht ungefährlich, weil da in eine minuziös—realistische Erzählweise plötzlich Poesie und Ekstase einbrechen und sich einen solchen Effekt nur leisten kann, wer sich sicher ist, sein Publikum bis dahin durch keinen einzigen falschen Ton irritiert zu haben. Aber damit nicht genug. Pipe arbeitet mit seinem „Herrn“ auf der Weide. Er sieht und hört die vorbeifahrenden Motorräder mit den freundlich winkenden Menschen, hört das Lachen der Kinder im Reisebus, der vorübersaust, nimmt mit einmal mehr wahr als zuvor und bemerkt auch, dass eigentlich alles um sie beide herum in Bewegung ist und nur sie beide wie „festgenagelt“ sind. Als er schließlich ein Segelflugzeug über sich entdeckt, ist es mit seiner Beherrschung vorbei. Er schmeißt den Hammer hin, schnappt sich sein Fahrzeug und haut ab. Durch die Wälder, über die holprigen Wege, immer den Spuren des Himmelfliegers folgend. Bis auf einen Berg. Pipe stößt sein Vehikel bis zu dem Gipfel eines Berges hinauf, stößt gewissermaßen in bis dahin für ihn unerreichbare Höhen vor. Da steht er nun, ergriffen und eingenommen von dem Bild, was sich ihm bietet. Und als der Segler an ihm vorbeischwebt, schreit er ihm zu: „Ca va?“. „Der Segler schwebt in den abendroten Himmel, wird immer kleiner. Nun dreht die Kamera um, fasst Pipe groß ins Bild: dicke Tränen rinnen ihm über das zerfurchte Gesicht. Mit Tränen in den Augen steht Pipe der Ewigkeit gegenüber. Man kann das wirklich nicht anders sagen“ (Martin Schaub in der „Weltwoche“).
Aber auch hierbei bricht der Film nicht aus, wird nicht zu jenem Melodram, das den Alten von nun an zu einem „neuen Leben“ verhilft, wo sich die Dinge in Wohlgefallen auflösen und alle Beteiligten in Zufriedenheit aufgehen. Pipes Drang wird jäh unterbrochen und beendet, als er sich auf einem Rummelplatz besäuft und mit seinem Fahrzeug einen (harmlosen) Unfall baut. Mit dem Fahren ist es damit vorbei. Aber Pipes Gram ist nur kurz, er entdeckt ein neues Betätigungsfeld: das Fotografieren. Mit einer Sofortbildkamera, die er auf dem Rummel gewonnen hat, geht er auf die Suche. Er knipst sich und die anderen bei ihrer täglichen Arbeit, entdeckt dabei einiges von dem, was sich wirklich auf dem kleinen Grund und Boden zwischen den Menschen abspielt. Pipe wird fähig, die Wirklichkeit zu begreifen. Und das bringt ihn plötzlich zum Reden. „Es gibt nicht nur die Arbeit“, sagt er zum verdutzten Bauern, als der ihm wieder einmal seinen „sonderbaren“ Lebenswandel vorhält. Und sogar: „Behalt Dein Geld“. Und dann erfüllt er sich seinen Lebenstraum – die „Besteigung“ des Matterhorns (dessen Foto sein Zimmer schmückt). Mit dem Helikopter geht es hoch. „Alles Felsen“, meint er zum Piloten. „Ja, wieso?“, erwidert der, „Haben Sie gemeint, das wäre hier Zuckerguss?“. Pipe will zurück. Er hat seinen Traum gehabt, und „unten gibt es noch viel zu tun“.
Ein wunderbarer Film. Er ist eine Art direkte Fortsetzung solcher (Leinwand-)’Fluchten‘ wie „Harry und Toto“ (USA) und „Pourquoi Pas!“ (Fr 1977). Aber im Gegensatz zu den bisweilen eher märchenhaft-spielerischen Stil dieser Vorläufer, ist “ Les petites fugues“ in seiner Utopie sehr viel konkreter, ehrlicher. Denn Yves Yersin, der bei seinem Spielfilmdebüt mit einer geradezu nachtwandlerischen Sicherheit stets den richtigen Ton und das richtige Bild parat hat, erzählt neben der Selbstfindungsgeschichte des alten Pipe auch etwas über die Regeln und die Ordnung einer Gemeinschaft, die sich im Umorientieren befindet, der dieses aber offensichtlich einige Schwierigkeiten bereitet. Neben der, unter der erstaunlichen Mithilfe des Hauptdarstellers MICHEL ROBIN, bedachtsam und mit sorgfältigem Humor inszenierten kleinen privaten Revolution kommen auch Fakten und Details ins Blickfeld, die keineswegs nur für den schweizerischen Landschaftsraum ihre Wertigkeit besitzen. Wenngleich das alles natürlich von der Person des Pipe und seiner ereignisreichen Wandlung ausgeht: 50 Jahre war er Knecht. Jetzt ist er Mensch. Brecht hätte seine helle Freude an dem Film (= 5 PÖNIs).