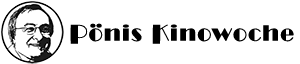|
Eine erste Liebe im Frühling. Aber: Es ist ein Frühling mitten im Krieg. „INGE, APRIL UND MAI“ von Gabriele Denecke und Wolfgang Kohlhaase (B+ R; D 1992; 86 Minuten; Start D: 22.04.1993); spielt im Frühjahr 1945. Doch von diesem Krieg und von dieser Zeit ist kaum etwas zu sehen und selten etwas zu spüren. Aber weiter: Jungs und Mädchen auf dem Spielplatz. Alles funktioniert in ihrer Welt, keine sonderlichen Störungen. Der Krieg ist zwar “da“ und doch irgendwo, irgendwie weit weg. Kalle, der 15-jährige, hat sich in Inge verknallt. Darum geht es hier. Verbotene Blicke, schaukelnde Mädchen, umständliche Berührungen. Kleine pubertäre Tupfer. Man probiert erste Gefühle und weil mit denen kaum umzugehen. Und während sich diese kleinen, szenenhaften Geschichten abspielen, vollzieht sich drum herum Geschichte. Die Briten bombardieren Kalles Heimatort, unweit von Berlin, und die Rote Armee ist im Anmarsch. Doch wir erfahren nichts vom Alltag der Menschen. Wir sehen nur unwichtige Pappkameraden, hören die Alibi—Sätze eines pazifistischen Lehrers und die Durchhalteparolen der Nazis im Luftschutzkeller. Die klingen genauso am Ohr vorbei wie die Bilder belanglos am Auge vorbeihuschen. Ohne anzuhalten, ohne zu treffen, geschweige denn zu berühren und zu interessieren. Nebenfiguren tauchen auf und treten ebenso schnell wie unverbindlich wieder ab: Inges Vater, offensichtlich ein Nazi, der vergeblich seine Familie zum kollektiven Selbstmord drängt. Eine Tante, die von russischen Soldaten klagelos vergewaltigt wird. 100 Gramm Puddingpulver als Beute bei einer Plünderung. Streiflichter, die austauschbar sind und nicht ansprechen. Ihre Gleichgültigkeit übertragt sich auch auf den Betrachter: Was immer hier vorgeführt und gesagt wird: Es ist egal. Der Film “Inge, April und Mai“ lahmt und lähmt. Und das fortwährend. Die autobiographisch gefärbten Bilder des Autoren und Co-Regisseurs Wolfgang Kohlhaase sind leblos. Das Milieu, in dem sie angesiedelt sind, nicht: Man spürt allerorten die aufgesetzte Künstlichkeit. Die jugendlichen Laien-Darsteller müssen einen fürchterlichen Stuss von Drehbuch-Papier aufsagen. Sie wirken hölzern und verkrampft: Sowohl in der laufenden Bewegung wie auch im stillen Ausdruck. Sie besitzen keinerlei Ausstrahlung, sind mit ihren Figuren nicht zu identifizieren. Einzig authentisch wirkt gegen Filmende, als nach Kriegsschluss gleich wieder getanzt wird, der alte Mann am Klavier: Es ist Paul Kuhn. Die einstige DEFA-Domäne, in der Ausstattung und in der Beschreibung von historischer Zeit mit Präzision zu überzeugen, wird hier ad absurdum geführt. Und vom Klischee mit den Russen, die tagsüber vergewaltigen und abends musizieren, können die beiden Film-Verantwortlichen Wolfgang Kohlhaase und Gabriele Denecke leider auch nicht lassen. Am endgültigen Ende findet sich dann noch ein Fazit: Man ist ratlos und wütend, ob solcher unsinnigen Bilder, wegen der schlampigen Filmerei und der armseligen Darbietungen. Wolfgang Kohlhaase, der seit Jahrzehnten zu den besten deutschen Autoren zählt, hat mit seiner ersten Film-Inszenierung eine glatte Bauchlandung hingelegt. “Inge, April und Mai“ ist ein Film der totalen Bedeutungslosigkeit (= 1 PÖNI). |
|||