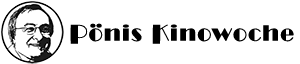PÖNIs: (2/5)
„ICH UND KAMINSKI“ von Wolfgang Becker (Co-B + R; D/Belgien 2013; Co-B: Thomas Wendrich; nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Kehlmann/2003; K: Jürgen Jürges; M: Lorenz Dangel; 120 Minuten; deutscher Kino-Start: 17.09.2015); er ist ein Schmarotzer. Ein Schnorrer. Redet andauernd munter drauflos, um ja nicht als sinnfreier Quatschkopf entlarvt zu werden. Hat nichts, ist nichts, obwohl er ständig das Gegenteil behauptet, macht sich und vor allem anderen permanent was vor. Überschätzt sich unangenehm. Hat sich in der Luxus-Wohnung seiner erfolgreichen Freundin eingenistet, die aber hat die Faxen von solch einem Blödmann jetzt dicke. Ein lausiger Opportunisten-Typ. Dieser Sebastian Zöllner (DANIEL BRÜHL), der sich Kunst-Journalist nennt und gut als personifiziertes Arschloch durchgeht. Und mit solch einer Luft-Figur soll ich mich nun zwei Kinostunden beschäftigen? Für „so einen“ soll ich mich 120 Lebensminuten lang interessieren? Da muss aber ganz schön „was passieren“, um an DEM dranzubleiben. Oder: Wie wird aus solch einem Vollpfosten ein reizvoller, interessanter filmischer Mittelpunkt?
Zöllner interessiert sich für einen legendären, fast vergessenen uralten Maler. Namens Kaminski (JESPER CHRISTENSEN). Der war Schüler von Matisse und Freund von Picasso und hat einst als blinder Maler für Aufsehen gesorgt. Zöllner will ihn aus der Versenkung holen, besser: zerren, eine Biographie über ihn schreiben, und wenn der greise Kaminski dann „zeitgemäß“ sterben würde, wäre der Erfolg garantiert. Denkt Zöllner und handelt entsprechend. Dringt bei dem Alten in seinem Chalet in den Alpen ein, lässt sich trotz Gegenwehr aus dem Umfeld des Seniors nicht mehr abschütteln. Zwei sture Egomanen-Böcke beginnen, sich verbal zu duellieren. Um dann schließlich gemeinsam eine alte Freundin von Kaminski in Belgien aufzusuchen (GERALDINE CHAPLIN), die sich jedoch als verhuscht und „abwesend“ erweist.
Mal hat man den Eindruck, Kaminski ist gaga, plemplem, dann wieder intellektuell-philosophisch auf geistiger Höhe. Bei Zöllner, wissen wir sowieso, ist alles fake. Der will auf Deibel komm‘ raus seine letzte Chance ergreifen, „wer“ zu werden. Anerkennung zu finden und endlich Geld zu verdienen. (Wir befinden uns kurz vor der Jahrtausendwende, wo Money immer „wichtiger“ wird).
Plump ist das. Inszeniert. Über-angestrengt. Gespielt. Fast anderthalb Stunden stolziert der Dämelsack von Zöllner – alias der hurtige Daniel Brühl – in einer langweiligen, völlig uninteressant wirkenden „Ich muss es schaffen“-Stellung über die gestresste Leinwand und törnt ab. Um dann in der letzten halben Stunde zum Gutmenschen zu läutern, der mit dem Alten Seelenfrieden schließt. Beziehungsweise umgekehrt – man verbrüdert sich. Am Meer („Knockin‘ On Heaven’s Door“ lässt grüßen).
Schlicht ist das. Weitgehend spaß- und spannungslos. Hohl entwickelt. Mit „so“ Anspielungen auf die Eitelkeiten = Hohlheiten eines Kunstbetriebes. Gähn. Lapidar. Hüftsteif. Gestelzt. Und dem Bemühen, aus uninteressanten Figuren irgendetwas heraus zu kitzeln. Der Film fremdelt. Besitzt keinen spannenden, lustintensiven Kribbel-Neugier-Geruch. Wirkt sonderlich; völlig „neutral“. Wer hier was, wann und warum macht, anstellt, bleibt zumeist unwichtig. Humorlos. Bedeutungslos. Emotional belanglos. Behauptet. Merkbar, also spürbar-angestrengt in Bewegung gebracht. Daniel Brühl wirkt bemüht, aber nie überzeugend. Vermag seinem Spinner nie aufregendes Leben einzuhauchen. Sein alter Kontrahent, Jesper Christensen aus Dänemark (der Mr. White aus den Bond-Filmen „Casino Royale“ + „Ein Quantum Trost“), ist mal als Tattergreis, mal als pfiffiger Altersnarr wenig nahegehend unterwegs.
Co-Autor und Regisseur Wolfgang Becker (zuletzt: „Good Bye, Lenin“/2003) kriegt keinen Schwung, kein Spannungsleben in seinen Film. Auch die dritte Kino-Adaption eines Daniel Kehlmann-Romans – nach „Die Vermessung der Welt“ von Detlev Buck (2012/s. Kino-KRITIK) und dem Episodenfilm „Ruhm“ von Isabel Kleefeld/2012 – ist weitgehend misslungen (= 2 PÖNIs).