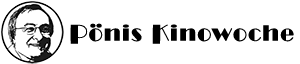|
Wenn Klaus Maria Brandauer in einem Film mitspielt, verwandelt sich die Leinwand in eine große, nach viel Atem und Wort ringende Bühne. Er beschreibt, das heißt er will beschreiben, den Lebensweg und das Schicksal des Varieté-Illusionisten und Hellsehers Klaus Schneider, der in den zwanziger und dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts als Eric Jan Hanussen zu einer markanten und umstrittenen Gesellschaftsfigur wurde. Dessen Fähigkeiten umjubelt und gefürchtet waren und der sich trotz anfänglicher Abstinenz in die braunen politischen Machenschaften mitreißen ließ und darin unterging. Klaus Maria Brandauer i s t Hanussen und triumphiert nach „Mephisto“ und “Oberst Redl“ zum drittenmal in und mit einer bizarren Künstler- und Politfigur. “Hanussen“ ist ein Film der Behauptungen, während die politischen Landschaften ebenso wie die Menschen unerkannt vorbeiwischen. Was bleibt ist ein beachtlicher Auftritt eines großen und großartigen Schauspielers, der “Hanussen“ zu seinem Film und Anliegen macht (= 2 ½ PÖNIs). |
|||
x