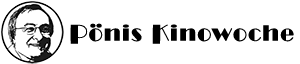|
„AN EINEM SAMSTAG“ von Alexander Mindadze (B+R; Russl/Ukr/D 2010; 99 Minuten; Start D: 21.04.2011); das ist der (nach „Soar“/2007) zweite eigene Spielfilm des 1949 in Moskau geborenen, renommierten Drehbuch-Autoren („Plumbum oder ein gefährliches Spiel“/1986; „Ein Stück für einen Passagier“/1995). Der hier ein bitteres Ereignis aus der Sowjetunion von 1986 zum Anlass nimmt, vom menschlichen Tanz auf dem Vulkan zu erzählen. Es ist Sonnabend, der 26. April 1986, ganz früh am Morgen. Als im Atomkraftwerk von Tschernobyl Block IV explodiert. Und durch die geborstene Hülle die lebensbedrohlichen Strahlen freigesetzt werden. Doch weil nicht sein kann was nicht sein darf, reagieren die Partei-Verantwortlichen nicht. NOCH nicht. Spielen alles herunter. Wiegeln ab. Schließlich ist Wochenende. Wo die Werktätigen frei haben. Feiern dürfen. Spaßhaben sollen. Wieso also eingreifen? Wegen „so etwas“??? Wird schon nicht so schlimm sein. Und werden. Also bleibt alles ruhig. Es ist eigentlich nix passiert. Das Leben ist schön. Uns kann nichts passieren. Alles andere ist üble Propaganda. Die Sonne scheint, das Gras ist grün, es ist Samstag. Also spazieren die Menschen in der nahegelegen 49.000 Einwohnerstadt Pripjat wie an jedem Samstag unbeschwert herum, machen ihre Besorgungen. Treffen Bekannte und Freunde. Kinder spielen im Freien. Die Feiern zum 1. Mai stehen bevor. Ein ganz normaler Tag. Ein ganz normaler Tag? Von wegen. Der junge Parteisoldat Valerij (ANTON SHAGIN) weiß bescheid. Hat mitbekommen, was tatsächlich Fürchterliches, Unvorstellbares „direkt vor der Haustür“ passiert ist. Und will bloß weg von hier. Sucht nach seiner Freundin Vera (SVETLANA SMIRNOVA-MARTSINKIEVICH), möchte mit ihr zum Bahnhof flitzen, um mit dem nächsten Zug abzuhauen. Doch nichts will gelingen. Als wäre man unsichtbar an diesen Ort der Katastrophe gefesselt. Für immer und ewig. Schuld daran – ein verborgter Pass, ein gebrochener Schuhabsatz, der verpasste Zug. Das Hochzeitsfest. Die Band. In der Valerij einst mittrommelte und Vera noch singt. Also – Bühne frei. Der Tanz kann beginnen. Der Wodka fließt. Wozu aufregen? Wir wollen nur glücklich sein. In diesem Moment. Nastrowje. Oder so. Als „An einem Samstag“ in diesem Februar im Wettbewerb der BERLINALE lief, war der Film als eine Art „warnende Pflichtübung“ zum 25. Jahrestag des Reaktorunglücks von Tschernobyl zu werten. Der in Form eines authentischen Dokuments, mit energischer, schneller Handkamera und unscharfer Nähe, gedrehte Streifen, besitzt aber seit dem 11. März 2011 eine ganz andere Warn-Bedeutung. Stichwort: Fukushima. Damals die Sowjetunion, heute Japan. Die nicht zu kontrollierende Atomenergie. Und die zögerlichen, halbherzigen offiziellen Reaktionen, damals wie heute. Parteiapparat dort, Betreiberfirma hier. Es wird abgewiegelt. Erklärt. Beruhigt. Abgewiegelt. Weitergemacht. Mit dem Tanz auf der Weltkugel. Wir können schließlich nicht „deswegen“ mal an-/einhalten. Außerdem ist Fukushima doch ganz ganz weit weg. Solchermaßen Sicht heute. Jetzt. Im Moment. Bei einem Film, der nur während der ersten 40 Minuten wirklich fesselt. Wenn er direkt „dran“ ist. Am Werk und am Thema. Und sich danach auf die „reichlich dummen“ Protagonisten stürzt und das eigentliche Dilemma nur ständig „denken“ lässt. Mit dem Wissen von heute. Natürlich wirkt der Film dennoch permanent. Verstört. Macht fassungslos. Wenn die Beteiligten wie paralysiert (nicht) reagieren. Die grauenvollen Ereignisse einfach nicht wahrhaben, abschütteln wollen. Verdammt nochmal ihr Oberidioten, warum begreift ihr nicht? Warum haut ihr nicht ab? Seid ihr bescheuert? Könnt oder wollt ihr nichts verstehen? Was macht ihr? Wieso spielt ihr mit eurem Leben? Ihr Blödiane…? Die menschlichen Unzulänglichkeiten. Diese normalen Verdrängungen. Die tägliche Dosis Betäubungen. DIE sind das Eigentlich-Gemeine. Denn wir ahnen, angesichts dieses eher „läppischen“ Katastrophen-Films, das Wir-Hier wahrscheinlich so oder so ähnlich oder so überhaupt vielleicht auch reagieren könnten. Wenn „es“ denn mal in unserer Nähe passieren sollte. Die Hilflosigkeit, diese verdammte Hilflosigkeit, und das Wissen darum, machen – in Gedanken – wütend. Sauer. Wir heißen plötzlich auch Valerij. Und Vera. Und möchten aufbegehren. Möchten gegen diesen Film protestieren. Wir sind „so“ nicht. Wir können und wissen und tun es besser. Oder umgekehrt. UNS passiert DAS nicht. Der Film „An einem Samstag“ wirkt wie ein verstörender, aufstoßender Magenbitter (= 3 ½ PÖNIs). |
|||
x