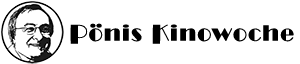„DIE ZWEI GESICHTER DES JANUAR“ von Wolfgang Storch (B+R; D 1984; 113 Minuten; Start D: 17.04.1986)
„DIE ZWEI GESICHTER DES JANUAR“ von Wolfgang Storch (B+R; D 1984; 113 Minuten; Start D: 17.04.1986)
“Mich haben immer nur die kriminellen Anlagen und Möglichkeiten des Normalmenschen in der Gesellschaft beschäftigt. Dabei ist mir die Aufklärung eines Mordfalles völlig gleichgültig. Gibt es etwas Langweiligeres und Gekünstelteres als Gerechtigkeit“, sagt die zurückgezogen in Frankreich lebende amerikanische Kriminalschriftstellerin Patricia Highsmith, nach deren gleichnamigen, 1964 erstmals veröffentlichen Roman dieser deutsche Film entstand.
Er handelt von drei Personen, die durch einen ungewollten Mord miteinander verstrickt werden und schicksalhaft nicht mehr voneinander loskommen. Der in Athen lebende junge Amerikaner Rydal Keener (Thomas Schücke), der dort auf der selbstgewollten Flucht vor seinem Elternhaus zur Ruhe gekommen ist, trifft eines Tages im Januar auf einen Mann, der seinem kurz davor verstorbenen Vater bis aufs Haar ähnelt und heftet sich an seine Fersen. Dieser Mann, Chester MacFarland (Charles Brauer), hat Dreck ein Stecken, wird wegen geschäftlicher Unregelmäßigkeiten von der amerikanischen Polizei gesucht und wähnt sich nun auch hier verfolgt. Als er sich mit seiner schönen, jungen Frau aus dem Staub machen will, überrascht sie ein griechischer Polizist. Chester gerät in Panik und tötet ihn. Rydel wird zufällig Zuge und ist nun Wissender und Beteiligter. Ohne zu überlegen, hilft er den Beiden und begibt sich mit ihnen auf eine ziellose Reise durch das Land, währenddessen sich die zwischenmenschlichen Positionen der Drei verändern. Auf Kreta schließlich kommt es zur endgültigen Katastrophe.
Es gibt überzeugende P.H.-Filmadaptionen, welche das einhalten, was Boileau-Narcejac einmal in “Le roman policier“ über die Highsmith- Literatur so treffend formulierte: “Sie verachtet den Fall und studiert dafür das Verhalten des Schuldigen, aber sie vergisst darüber niemals die Story, die stets abwechslungsreich, logisch, packend ist“. Leider hält sich diese Verfilmung, die in Co-Produktion mit dem Süddeutschen Rundfunk entstand, überhaupt nicht an diese Fakten und macht aus dieser Story eine Art Courts-Mahler-Geschichte, gepaart mit Edgar-Wallace- Appeal. In einem Postkarten-Griechenland, das nichts von der Mystik, “von den Überresten einer archaischen Kultur“ (Presseheft) widerspiegelt, sondern nur normale Landschaft, spielen drei Personen eine Operetten-Affäre. Älterer Ehemann, junge, heiße Frau, junger Liebhaber. Jeder ist auf jeden angewiesen, jedenfalls wird das ständig behauptet, deshalb bleibt man zusammen. Was sie tun, wie sie sich bewegen, was sie reden, ist unbedeutend oder unfreiwillig komisch, es gibt haufenweise Leerlauf und Füllszenen, um schließlich zum schon völlig unwichtigen Ende zu kommen. Die Psychologie hier ist so plump wie die Musiksuppe, die jedes Mal mehr “ankündigt“ als die Bilder zu liefern in der Lage sind.
Die drei Akteure wirken bei dieser fernsehspielhaften Inszenierung wie hingestellt und alleingelassen und dürfen auch noch die psychologischen Handlungsweisen in einem hölzernen, albernen Dialog-Geplapper ständig erläutern. Während Colette mit dem Charme einer primitiven, geilen Tussi behaftet ist, die nur ihr unausgefüllter Unterleib interessiert. “Das ist doch schwachsinnig“, hat sie einmal mittendrin einer sich anbahnenden Männerkeilerei entgegenzuhalten, und dies zieht sich fortan durch diesen Streifen, der im Kino absolut nichts zu suchen hat (= ½ PÖNI).