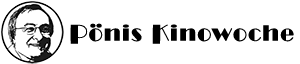„SOMMER IN ORANGE“ von Marcus H. Rosenmüller (D 2010; B: Ursula Gruber; K: Stefan Biebl; M: Gerd Baumann; 110 Minuten; deutscher Kino-Start: 18.08.2011); basiert auf den Kindheitserinnerungen der Drehbuch-Autorin Ursula Gruber und ihres Bruders, des Mit-Produzenten Georg Gruber. Der am 21. Juli 1973 in Tegernsee geborene Marcus Hausham Rosenmüller hatte ja mit seinen Anfangsfilmen „Wer früher stirbt ist länger tot“ (2006/“Deutscher Filmpreis“/rd. 1,8 Millionen Besucher) und „Schwere Jungs“ (2007/über 550.000 Interessenten/s. Kino-KRITIK) einen fulminanten Debüt-Kinostart. Inzwischen ist die „hohe Luft“ – nach u.a. „Räuber Kneissl“ (2008/mit Maximilian Brückner/s. Kino-KRITIK) sowie „Die Perlmutterfarbe“ (2009) – etwas „`raus“. Siehe diese neueste Produktion des oberbayerischen Talents. Die ziemlich verpufft, obwohl das Thema einiges verspricht.
„SOMMER IN ORANGE“ von Marcus H. Rosenmüller (D 2010; B: Ursula Gruber; K: Stefan Biebl; M: Gerd Baumann; 110 Minuten; deutscher Kino-Start: 18.08.2011); basiert auf den Kindheitserinnerungen der Drehbuch-Autorin Ursula Gruber und ihres Bruders, des Mit-Produzenten Georg Gruber. Der am 21. Juli 1973 in Tegernsee geborene Marcus Hausham Rosenmüller hatte ja mit seinen Anfangsfilmen „Wer früher stirbt ist länger tot“ (2006/“Deutscher Filmpreis“/rd. 1,8 Millionen Besucher) und „Schwere Jungs“ (2007/über 550.000 Interessenten/s. Kino-KRITIK) einen fulminanten Debüt-Kinostart. Inzwischen ist die „hohe Luft“ – nach u.a. „Räuber Kneissl“ (2008/mit Maximilian Brückner/s. Kino-KRITIK) sowie „Die Perlmutterfarbe“ (2009) – etwas „`raus“. Siehe diese neueste Produktion des oberbayerischen Talents. Die ziemlich verpufft, obwohl das Thema einiges verspricht.
Anno 1980 in dem bayerischen 100% CSU-Kaff Talbichl. Hier ist die Welt voll überschaubar. „Keine Experimente“ in der Gemeinde. Der erzkonservative Herr Bürgermeister (HEINZ-JOSEF BRAUN) sorgt für „Anstand“ und Ordnung. Mit Trachten, Blasmusik und dem täglichen gemeinsamen Schulgebet vor dem Unterricht. Und am Sonntag geht’s in die Kirche. Eine Bravheit und Ruhe will er ständig haben. Aber damit ist nun Schluss. Denn ausgerechnet in SEIN Dorf hat es eine Bhagwan-Gruppe aus Berlin-Kreuzberg verschlagen. Einer „von denen“ hat nämlich einen Bauernhof geerbt. Fortan ist hier „Love and Peace“ angesagt. Das ganze Programm. Mit Orangen-Gewändern, Nackt-Yoga im Garten, einer offenen Sexualität oder der Urschrei-Therapie in der Scheune.
Soweit so neckisch. Ab sofort aber verhaspeln sich Rosenmüller & Team. Indem sie viel zu viel angestrengt wollen. Der kulturelle Crash auf dem Dorf, der – listig beobachtet und süffisant erzählt – alleine schon ein unterhaltsames Reiz-Thema hergeben könnte, ist nur Ausgangspunkt für die Problemgeschichte der 12-jährigen Lili (fesch: AMBER BONGARD). Die sich zu Recht von ihrer (überkandidelten) Mutter nicht genügend beachtet und versorgt fühlt. Und zunehmend als Exotin zwischen „dürfen“ und „nicht-dürfen“ neugierig pendelt. Sozusagen zwischen Sojabohnen und Wurstsemmel. Dabei aber eigentlich ganz „normal“ aufwachsen möchte. Mit Mantra UND Dirndl. Um endlich Anerkennung zu finden. Zudem beobachtet sie die zunehmenden (An-)Spannungen in der Clique, wo ganz normale bürgerliche Verhaltensweisen wie Misstrauen und Eifersucht hervortreten und der gepredigten Rundumfreude und Gruppendynamik arg entgegenstehen.
Der Film zerwuselt in viele uninteressante Problembaustellen. Dadurch wird die Nähe zu Personen zugekleistert. Und das Interesse an diesem (vorhersehbaren) Beziehungsgeflecht ermattet. Das ironische Potenzial dieser prekären, dörflichen wie weltlichen Kulturkonfrontation wird nur ansatzweise angedeutet; insgesamt ist „Sommer in Orange“ mit zu viel bajuwarischem Holzhammer- und zu wenig satirischem Karma-Charme beseelt. Besitzt also viel zu wenig von diesem augenzwinkernden OOOOOmmmmm-Gefühl (= 2 PÖNIs).