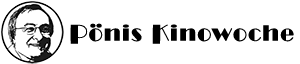PÖNIs: (4,5/5)
„MOONLIGHT“ von Barry Jenkins (B + R; nach dem Bühnen-Projekt „In Moonlight Black Boys Look Blue“ von Tarell Alvin McCraney; K: James Laxton; M: Nicholas Britell; 111 Minuten; deutscher Kino-Start: 09.03.2017); manchmal gibt es doch diese unglaublichen Überraschungen, denn wie anders soll man es erklären, das „solch ein Film“, hergestellt für ein Mini-Budget von 5 Millionen Dollar, plötzlich die Welt verzaubert und von den „Oscar“-Juroren, nach achtfacher Nominierung, mit drei „hohen“ Trophäen bedacht wird: Für das „Beste adaptierte Drehbuch“; für den „Besten Nebendarsteller“ MAHERSHALA ALI sowie – die Königskrönung – für den „Besten Film“. Aber warum „solch ein Film“?
„Moonlight“ erzählt, in drei Kapiteln, vom schwarzen Boy/Jungen/Mann Chiron, der in den 1980er Jahren in einer Ghetto-Gegend von Miami, in Liberty City, als Sohn einer cracksüchtigen Mutter aufwächst, grobe Misshandlungen seitens seiner Mitschüler durchlebt, die ihn als „Weichei“ diskreditieren und verfolgen; der schließlich als Heranwachsender seine Homosexualität entdeckt, was sein Leben alles andere als leichter macht; und der sich dann schließlich doch „wehrt“, was ihm eine langjährige Jugendhaftstrafe einbringt; um sich dann als Erwachsener äußerlich „den Gepflogenheiten“ des Milieus-hier zu präsentieren: nämlich muskelbepackt, mit goldenen Grills und Goldketten. Mit dem körperlichen Signal: Das „mit dem Opfer“ ist endgültig vorbei. Und der künftig dennoch SEIN individuell-bestimmtes Wunsch-Leben möglicherweise und endlich realisieren wird.
„Little“ nennt man Chiron in der Penne. Also geringschätzend „Bubi“. Weil er sich nicht wehrt, mit den rüden Rollen-Macho-Spielen seiner Umgebung nichts am Hut hat, dadurch als Individuum und Persönlichkeit keine Anerkennung findet. Im Gegenteil, durch sein anderes, also eigenes Ich, sich den Zorn und den Hass in seiner täglichen Umgebung zuzieht. Zuhause kann Chiron keine Unterstützung erwarten, denn seine alleinerziehende Mutter befindet sich meistens auf dem nervösen Sprung zum nächsten Drogen-Kick.
Ihr Bemühen, ihren Sohn zu (be-)schützen, ist gering. Als Chiron (ALEX R. HIBBERT) Juan kennenlernt, einen aus Kuba stammenden Einwanderer und Drogendealer (MAHERSHALA ALI), ist und wird das zu seinem Glück. Denn Juan und seine Freundin Teresa (JANELLE MONÁE) öffnen Chiron nicht nur die häusliche Tür, sondern beginnen auch, sich um ihn zu kümmern. Juan wird für Chiron so etwas wie ein Ersatzvater. So dass der schmächtige Junge nach und nach beginnen kann, sich aus seiner entsetzlich traurigen und sprachlosen Daueranspannung zu lösen. Wenngleich sein Lebensweg weiterhin mit vielen Fragezeichen und Widersprüchen gepflastert ist. Beispielsweise, als er zur Kenntnis nehmen muss, dass Juan auch seine Mutter mit Drogen beliefert.
Was haben wir im Kopf, was sehen wir in Gedanken, wenn wir „so etwas“ hören? Natürlich: Elend. Mit seinen vielen armen wie ekligen Bildern. Mitten drin: Die nach Mitleid, Erbarmung und Erlösung hechelnde Märchengeschichte um einen schwulen Außenseiter, der es schließlich „doch“ nach oben schafft? Pustekuchen. Der heute 37-jährige Filmemacher und Drehbuchautor BARRY JENKINS wollte und will genau diese Kino-Klischees überhaupt nicht bedienen. Er selbst wuchs dort auf, wo Chiron aufwächst; er hat genau-dort vieles von dem erfahren, was er jetzt wiederspiegelt.
Auf der einen Seite diese drangsalierenden Großmäuler, die es gerne auf Schwächere absehen, Stereotypen der Region; auf der anderen Seite die „Anderen“: Die mit mitmenschlichen Zügen, die diesem gesellschaftlichen Krank-Gebilde eben nicht entsprechen und dadurch mit ihrem enormen Empfindungspotenzial in seelische Schieflage geraten. Wie dieser einem immer näherkommende Chiron, den wir über mehr als 15 Lebensjahre begleiten und der von drei großartigen Schauspielern eindrucksvoll dargestellt wird: außer Alex R. Hibbert (das Kind) auch ASHTON SANDERS (der Jugendliche) und letztlich TREVANTE RHODES als Chiron, „The Black“.
Barry Jenkins beschreibt in Interviews immer wieder, wie er selbst über Solidarität und Zuneigung in Liberty City dem „möglichen Verfall“ entkommen konnte. Er vermittelt ein Menschen-Bild, das den herkömmlichen Erzählungen und Bildern aus dieser Region, aus solch einem Milieu, entgegen-spricht, -handelt, -fühlt. Einen schwarzen Drogendealer, der Verantwortung für einen kleinen, seelisch zerschundenen, afroamerikanischen Jungen übernimmt, hat es meines Wissens in dieser Charakter- und Emotionseindringlichkeit noch nie in einem amerikanischen Film gegeben. Und: Angesichts der gegenwärtigen politischen Führungszustände in den USA bekommt der (vor Trump entstandene) Jenkins-Film auch einen wichtigen aktuellen, gesellschaftlich-universellen Qualitätsstempel: Ein Mensch ist ein Mensch, ist immer ein Mensch. Andere „Bezeichnungen“ sind unangemessen, fatal, rassistisch.
Diese überzeugenden Schauspieler, dieses dichte, großartige Ensemble. „MOONLIGHT“, der Film, ist Menschen-spannend. Besitzt eine einzigartige Gefühls-Stimme im modernen, amerikanischen Kino, vermag verblüffend-magisch wie energiegeladen-emotional große Gefühle auf die Leinwand zu transportieren. Die Schluss-Sequenz geht buchstäblich unter die Haut.
„Moonlight“, der wunderbare Film, mit seiner intimen Kamera und seiner „humanen“ Musikalität, ist eben keine Klageschrift, sondern öffnet atmosphärisch-tief und sehr berührend Augen und Herzen (= 4 ½ PÖNIs).