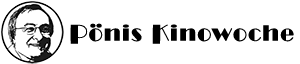„VA BANQUE – Der K(r)ampf um einen deutschen Film“ von Hans-Ulrich Pönack (ca. 1986)
„DIETHARD KÜSTER“ , Jahrgang 1952, aufgewachsen in Dortmund, Abitur. 1972 Übersiedlung nach Berlin, um Germanistik, Politik und Erziehungswissenschaft zu studieren. 1979 Magister-Abschluss. „Bin dann über Großstadtsituation Berlin/Scene, man kennt jeden, man macht da was, in diese Filmerei über die Film- und Fernsehakademie reingerutscht“. Veranstaltete 1978 das TUNIX-Festival, bei dem Godard zu Gast war, arbeitete als freier Journalist für verschiedene Publikationen und schließlich im dramaturgischen Bereich bei diversen Film- und Fernsehproduktionen (DFFB, SFB). „Ich habe Germanistik nur unter dem Aspekt der Umsetzung von Phantasie in eine ästhetische Form, in Kunst, studiert. Was ein Rocksong sein kann, ein Bild, Literatur und eben sehr viel mehr auch Film“.
1982 einer der drei Mitbegründer der „Fuzzi Film Produktion“. Erste TV- und kleinere Filmarbeiten (u.a. die 16mm-Farbproduktion „At The Last Wall – Kevin Coyne im Tempodrom“, die 1984 auf dem Münchner Filmfest lief). 1984 entsteht das Drehbuch für den ersten abendfüllenden Spielfilm „Va Banque“, seitdem mit der Realisierung und Vermarktung dieses Films beschäftigt.
Die Erfahrurgen der Mitarbeit an deutschen Filmproduktionen haben Diethard Küster nachhaltig geprägt. „Die Lieblosigkeit, mit der meistens das Handwerk ausgeübt wird; mitzubekommen, dass Regisseure oft froh sind, wenn abends am Schneidetisch überhaupt Muster zu sehen sind; zu erleben, wenn die Beteiligten zufrieden sind, überhaupt eine Kamera in Gang gebracht zu haben, hat mir Größenwahn wie Selbstbewusstsein gegeben, das doch anders, besser zu versuchen“. Ein Ergebnis davon sei beispielsweise, „dass so viele kleine Rollen in meinem Film so liebevoll besetzt sind“: Joschka Fischer, Rio Reiser, Mink DeVille, Kevin Coyne, Rolf Zacher“. Küster mag die Filme von Peter Bogdanovich („The Last Picture Show“), Costa-Gavras und Melville, „also Filme, die vordergründig erstmal Kino und dabei nicht nur Form und Spektakel sind, sondern hinter einer konsumierbaren, faszinierenden Form auch immer Inhalte vermitteln“. Und „wo Personen nicht gut oder böse, sondern gebrochen angelegt sind“. Küster hat eine Vorliebe für Gangster-Stories. Als Ende der siebziger Jahre die ‚Hammer-Bande‘ in die Schlagzeilen geriet („die so ein bisschen was vom englischen Postraub hatte“), kam zum ersten Mal die Idee zu einem Film.
„Das war Ganovenhaftes mit Esprit, da gab es zwölf Überfälle ohne einen einzigen Schuss“. Der zweite Strang zu seiner Film-Story war, „dass viele heute in Berlin von Anfang bis Mitte der Siebziger aus irgendwelchen Kneipen-Emotionen heraus in militante Geschichten reinrutschten, weil die Stimmung halt so war und das dann auch noch lief. Einige sind heute tot oder sitzen im Knast, andere sind Anwälte oder Ärzte geworden“. Aber „ich wollte weder einen Politfilm über die RAF noch über den 2. Juni noch einen reinen Schwarz-Weiß-Genrefilm über Gangster mit Hut und Sonnerbrille machen, sondern dies mischen“.
Ein Exposé wurde erstellt und bei den Drehbuchförderungsinstanzen beim Bundesminister des Innern (BMI) und bei der Filmförderungsanstalt (FFA) eingereicht. Die Antworten waren sämtlich negativ. Dieser Stoff „sei fürs Kino nicht geeignet“. Standardablehnung per Vordruck, doch über interne Kontakte kamen ganz andere als (die im Filmförderungsgesetz/FFG vorgegebenen) wirtschaftlichen und qualitativen Überprüfungskriterien zutage: „‚Qualität reicht fürs Kino nicht aus‘, war nur der vorgeschobene Ablehnungsgrund“, erfuhren Diethard Küster und seine Produzentin Manuela Stehr, „hinter vorgehaltener Hand dagegen lautete der Tenor bei diesem Fünfer-Gremium – das Buch, der Film würden anarchistisch, hier würden Verbrecher verherrlicht“. Ganz klar eine politische Maßregelung, meinen die beiden. Trotzdem wollte Küster von der Filmidee nicht ablassen und schrieb ohne Unterstützung das Drehbuch. Gleich nach Fertigstellung wurden Überlegungen zum Casting angestellt. Denn um das Drehbuch zur Projektförderung einreichen zu können, „musst du im Prinzip schon ein komplettes Gerüst vorweisen können“ klären Produzentin und Autor auf. „Du musst schon den Kameramann ebenso benennen können wie den weiteren technischen Stab und die Besetzung!“ Auch wenn überhaupt noch nicht feststeht, ob das Ganze überhaupt jemals realisiert werden wird.
„Das ist ja gerade das Dilemma“, klagt Manuela Stehr. „DU musst sogar Erklärungen von denen vorweisen, dass sie sich wirklich bereiterklären, hierbei mitzumachen. Du musst Schauspielern Zusagen machen, obwohl du noch nicht eine müde Mark hast. Du musst schon einen Drehplan haben, eine Kalkulation mit Daten, Fakten, Absprachen“. Größere Produktionsfirmen hätten es da weitgehend einfacher, weil die sich drei weitere Projekte nebenher leisten könnten, „um dabei die jeweiligen Handlungsunkosten einzustecken und umzulagern“. Handlungsunkosten? „Das sind in der Filmförderung vorgesehene Kosten, die du dir als Produzent immer einstecken darfst. Sie betragen 7,5% vom Gesamtbudget, was nichts anderes bedeutet, als dass es immer denen finanziell gut geht, die zum Beispiel drei Filme pro Jahr produzieren. Die haben ihren reichlichen Gewinn immer drin, und denen kann es auch scheißegal sein, wie ja auch die deutsche Filmpraxis der letzten Jahre oft genug bewiesen hat‚ ob irgendein Film jemals ins Kino kommt oder nicht. Man verdient über den Produktionsablauf, nicht über den Kartenverkauf, mit der Produktion ist keinerlei eigenes Finanzrisiko verbunden. Unsere Handlungsunkosten übrigens“, so Diethard Küster, „stecken voll und ganz im Projekt“.
Der Antrag auf ein Darlehen der Projektförderung bei der FFA wird am 29. November 1984 gestellt. Ablehnung mit Bescheid vom 6. Februar 1985. Einstimmiger Tenor: ‚Nach §32 Abs.1 FFG setzt die Darlehensgewährung voraus, dass das Projekt aufgrund des Drehbuchs sowie der Stab- und Besetzungsliste einen Film erwarten lässt, der
geeignet erscheint, die Qualität und die Wirtschaftlichkeit des deutschen Films zu verbessern!‘. Dann folgt die drei Sätze umfassende praktische Begründung der 11er Kommission (mit Vertretern aus u.a. Bundestag, Bundesrat, den Verbänden von Theater, Produzenten, Journalisten, Kirchen, Fernsehen): „Die Kommission lehnt den Antrag einstimmig ab. Sie hält das Projekt eher für einen Tatort-Krimi geeignet, als für einen Kinofilm. Es fehlt die ironische Perspektive. Das Projekt gerät nach Auffassung der Kommission zu naturalistisch ohne Gefühl für künstlerische Ökonomie“.
Anderthalb Jahre Arbeit im Eimer? „Wir haben mitgekriegt, dass Anfängerproduktionen spätestens an dieser Stelle aufgeben. Uns kam aber zugute, dass Manuela Juristin ist und während ihrer Referendarzeit auch bei der FFA gearbeitet und dort ihre Erfahrungen gemacht hat“. So wurde gegen die fünfzeilige Ablehnung auf acht Seiten begründeter Einspruch erhoben. Das Problem dabei sei gewesen, niemanden aus diesem Gremium zu kennen und doch versuchen zu müssen, „irgendwie auf die einzugehen, um zu zeigen, dass du ihnen entgegenkommst. Dabei darfst du sie nicht verletzen, also den Fehler von vielen nicht wiederholen, nur rein emotionell zu argumentieren“. Es galt irgendwie herauszubekommen, was die eigentlichen Ablehnungsgründe waren. Zufällig war drei Wochen danach die Berlinale, „wo es uns irrsinnig schwer gefallen ist, an die Mitglieder der Projektkommission einzeln heranzugehen, ohne unterwürfig zu sein und zu wirken“. Dabei äußerte sich beispielsweise das Mitglied Horst von Hartlieb gegenüber der Produzentin dahingehend, dass „Va Banque“ ein „ganz böser Film“ würde, der „extrem jugendgefährdend“ und „staatsvernichtend“ sei und „auf keinen Fall gezeigt werden“, sprich also überhaupt nicht erst entstehen darf.
Bei einigen anderen Mitgliedern stellte sich heraus, „dass die das Drehbuch überhaupt nicht gelesen hatten“ und nun bei der persönlichen Vorsprache von der Filmidee „angenehm überrascht“ waren. Gesine Strempel, eine seit Jahren in den Filmförderungsgremien sitzende Journalistin und Filmemacherin, nannte als ihren Ablehnungsgrund „das Vorkommen von Gewalt und Waffen“ und meinte darüber hinaus zur Produzentin, dass „dieser Stoff im Übrigen eine Verunglimpfung der RAF sei. Verunglimpfung der RAF?
„Da fällt einmal im Film der Satz, ‚da die Gruppe ja damals aufgelöst wurde, kann ich doch hier jetzt nicht einen alternativen Waffenverleih aufmachen‘. „Das war für sie“, so Manuela Stehr, „eine Verunglimpfung der RAF, weil das ja bedeute wurde, dass alle von damals im Keller noch irgendwelche Waffen zu liegen hätten und dies wieder den Film in so eine bestimmte Ecke drängen würde“. Auch Diethard Küster musste dann seine Ideen, sein Buch erklären. „Ich hab gesagt, es handelt sich hier um einen deutschen Film mit einem Überfall und einer Ganovenstory, bei dem nicht ein Tropfen Blut und nicht einmal irgendeine Fickerei drin ist. In jeder ‚Schwarzwaldklinik‘-Folge siehst du mehr!“ Tingeln, argumentieren, Überzeugen-Müssen war angesagt, eine Lobby aufbauen, „es war eine ziemlich schreckliche Zeit“.
Das Ergebnis war ein Antrag auf eine zehnminütige mündliche Anhörung vor dem 11ergremium der Projektkornmission. „Die verhandeln manchmal vierzig Projekte in ein paar Stunden, deshalb habe ich ihnen gleich nur zehn Minuten angeboten“, erklärt Diethard Küster. Obwohl auf eine einstimmige Ablehnung noch nie ein Widerspruch durchgekommen ist, kippte dann doch die Kommissionsmeinung um in eine 6:5-Zweitabstimmung f ü r eine Förderung. Besonders der ZDF-Filmredakteur Klaus Brühne und Frankfurts Kulturdezernent Hilmar Hoffmann („da haben wir doch schon viel schlimmere Sachen gefördert“) sollen sich für das Projekt stark gemacht haben. Damit stand der erste und wichtigste Finanzierungsteil des auf rund 1,5 Millionen Mark angesetzten Films. Das Gesamtbudget hatte folgenden Umfang:
350.000,- FFA-Mittel
250.000,- BMI-Förderung
400.000,- Berliner Landesförderung
293.000,- Eigenkapital
200.000,- Co-Produzent oder Fernsehen.
Die Regel ist, dass es nach dem FFA-Geld bei den anderen Stellen meistens sehr schnell mit der Bewilligung geht. Die FFA spricht, „wenn sie will“, eine Empfehlung zur BMI-Förderung aus, wobei „interessant daran ist, dass einige der FFA-Förderungskommissionsmitglieder auch in der Förderungskommission beim BMI sitzen“. Die Berliner Gelder bedeuten schließlich die letzte Bewilligung in dem System, die sagen fast immer ja, wenn die anderen ja gesagt haben“. Die erforderlichen Eigenmittel „musst du dagegen erst nachweisen, wenn es zur Auszahlung kommt“, und dazu gehören die Rückstellungen von zustehenden Gagen (für Drehbuch, Herstellung, Regie) ebenso wie Bankkredite und Privatgelder. Die restlichen 200.000 Mark wurden nach vielem Hin und Her von Luggi Waldleitner aus München mit seiner Firma ‚Roxy-Film‘ aufgebracht. Allerdings nicht aus purer Sympathie und schon gar nicht aus der eigenen Brieftasche, sondern als Referenzmittel von einem anderen Film. Diese Mittel bekommt man nach den hiesigen Förderungsstatuten, wenn bei einem Film 200.000 oder 130.000 Zuschauer kommen. Sie sind zweckgebunden und müssen innerhalb eines bestimmten Zeitraums in einen neuen Film investiert werden, sonst verfallen sie. Dieses Steuerzahlergeld hat, wie Diethard Küster und Manuela Stehr zu berichten wissen, in der Bundesrepublik zu einer neuen Art von Co-Produktionsarbeit geführt, bei der mit diesen Referenzmittelregelrecht gemakelt wird.
Da gibt es sogenannte Produktionsfirmen, die dir innerhalb von einer Woche 2 oder 300.000 Mark beschaffen. Im Vertrag wird dann ein zweiter oder dritter Geschäftsführer bestimmt, der 130 oder 150.000 Mark kostet. Ein fiktiver Posten, der denen ein Verdienst von rund der Hälfte der Summe einbringt. Und die sind ihrer Verpflichtung nachgekommen, haben Gelder investiert und haben dabei kräftig abgesahnt“. Dieses Spiel brauchten Küster und Partnerin aber nicht mitzumachen, dafür mussten sie andere „Knebelmaßnahmen“ ihres Co-Partners akzeptieren. Der bedingte sich aus, Verleih wie Video-Vertrieb selbst bestimmen zu können, bekam also plötzlich einen Einfluss, der seiner finanziellen Beteiligung keineswegs entsprach. Diethard Küster: „Luggi Waidleitner ist der erste, der, wenn Geld reinkommt, seine 200.000 Mark wieder zurückkriegt, bevor wir eine einzige Mark verdienen“. Manuela Stehr: „Und er kriegt die Hälfte der möglicherweise für unseren Film dann zustehende Referenzmittel von der FFA, obwohl er nur knapp zu einem Siebentel beteiligt ist“. Da sie unter Zeitdruck standen, mussten sie akzeptieren. „Wenn zu dem Termin nur ein Finanzglied geplatzt wäre, hätten wir mit unseren Verträgen dagesessen und Strafe zahlen müssen, wenn es nicht geklappt hatte mit der Produktion“. Schnitt.
Der Film wird doch noch im Sommer letzten Jahres realisiert, wird geschnitten, die erste Vorführkopie angefertigt. Nun muss ein Verleiher gesucht werden „, denn dabei hilft einem die FFA überhaupt nicht, obwohl es doch mit ihrer Erfahrung ein leichtes wäre“. Auf Druck des Co-Produzenten Luggi Waldleitner, so der Debüt-Spielfilmregisseur, wurde man zuallererst in München beim „Tivoli“-Verleih vorstellig, einem Verleih, der durch Sex und „Supernasen“-Filme Geld gemacht hat und mit dem Slogan „Aus Freude am Kino“ wirbt. „Es war eine ganz schreckliche Vorführung. Da saßen drei Verleih-Leute drin, und von der ersten Minute an kamen nur so Sprüche –’warum zieht die sich denn nicht ganz aus‘ (gemeint ist die Sängerin Joy Rider in der Anfangsszene/ d. Verf.) oder ‚ich wurde doch die Alte ficken statt fernzusehen’…, ich wollte mittendrin abbrechen. So sitzt du da, hast zum ersten Mal einen Spielfilm gemacht, in dem zwei Jahre Energie, Phantasie und Herzblut stecken, und dann kommen nur so Fick-Sprüche“. Natürlich ging man danach schnell ohne Kontrakt auseinander. Nachdem dann aber „Va Banque“ beim diesjährigen Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken nach „Männer“ die größte Zuschauerresonanz hatte, „da hat sich auf einmal dieser Verleih den Arsch aufgerissen, um doch den Film zu bekommen“. Und bot einen so günstigen Verleih-Vertrag an, u.a. Start am 1. Mai 1986 mit mindestens 30 Kopien bundesweit‚ dass kleinere Off-Verleih-Konkurrenten da nicht mithalten konnten.
Nach Vertragsabschluss aber war für ‚Fuzzi Film‘ lange Zeit Sendepause. Erst durch Eigenrecherche kommt man dahinter, da der Geschäftsführer des Verleihs, der diesen Vertrag unterschrieb, nicht mehr Geschäftsführer ist. Es existierte kein Werbematerial, bis Mitte März ist von Verleih-Seite kein Kino gebucht worden. Man war mittenmal in verleihinterne Querelen gerutscht. Aber was haben die mit dem Herausbringen des fertigen Films zu tun?
„Es geht um die Verleih- bzw. Absatzförderung“, klärt Diethard Küster auf. „Tivoli“ sei davon ausgegangen, dass nach der, wenn auch mühevoll zustande gekommenen Projektförderung die FFA selbstverständlich nach Fertigstellung auch die Absatzförderung bewilligen würde. „Die haben darauf spekuliert, sie kriegen 100.000 Mark Förderung, und von diesen investieren sie 50.000 in die Fremd-Arbeit wie Kopien, Werbung, und für ihre Arbeit stecken sie die restlichen 50.000 ein“. Das sei dort so gang und gebe, „Tivoli“ sei es egal, ob drei oder 300.000 ihre deutschen Filme sehen wollen, „denn sie verdienen auf jeden Fall über diese Absatzförderung. Und die haben dann unseren Film sofort fallen gelassen, nachdem sie Angst bekommen hatten, keine 100.000 Verleih-Absatzförderung zu kriegen“.
Dazu noch einmal die gesetzesmäßige Grundlage. Eine aus fünf Personen bestehende Kommission bestimmt, ob nach §53 Abs.1 Nr.1 FFG Absatzförderung zu bewilligen ist. Hier wurde sie deshalb u.a. abgewiesen, weil der Film „zu viel Fülsel und zu viel unartikulierte Musikteile hat, die für ein solches Filmgenre abträgliche Längen ergeben“. Natürlich sind das auch hier nicht die wahren Gründe, wissen Diethard Küster und Manuela Stehr zu berichten, sondern es geht dabei ausschließlich um den Schluss, der auch schon der Projektkommission, von denen nun hier fünf zu Gericht sitzen, was neue Mehrheitsverhältnisse schafft“ (Küster), unangenehm aufgefallen war. „Dabei haben wir doch nun schon einen alternativen Schluss geschaffen“, mokiert die Produzentin, „aber offensichtlich haben die Mitglieder der Absatzförderungskommission nur die letzte Rolle gesehen und sich dann verarscht gefühlt, weil Geld und Leute nicht da sind, wo sie in einem ordentlichen Staat hingehören. Dabei sind doch die Ganoven ihr geklautes Geld wieder los, so dass wir uns der gewünschten Aussage, ‚Verbrechen lohnt sich nicht‘, und nur darum geht es hier wirklich, doch schon sehr nähern“. Inzwischen läuft der nächste Widerspruch, was aber den Verleih wenig angespornt hat, so dass sich die Beiden jetzt selber darum bemühen, den Film, der am 1. Mai nur in insgesamt zehn Kleinstädten-Kinos und dort meistens auch nur in unappetitlichen Schachtelfilialen gestartet ist, in ansprechenden Kinos unterzubringen. Ein klarer Vertragsbruch, „aber was hilft es uns, wenn so ein Fall erst in ein paar Jahren verhandelt wird“.
Was lernen wir daraus, hat der Lehrer früher in der Schule öfters am Stundenschluss gefragt. Diethard Küster, der gestresste Autor und Regisseur: „Es gab während der Arbeit drei Phasen. Einmal das Geld aufzutreiben, und das war schon sehr frustrierend und erniedrigend, aber da dachte ich, das gehört dazu. Dann unter extrem schwierigen Bedingungen diesen Film zu realisieren, das war teilweise bittere Erfahrung. Schließlich diese grauenvolle Verleihgeschichte. Das alles kann dazu führen, dass ich nie mehr die Möglichkeit bekommen werde, einen weiteren Spielfilm zu machen, wenn „Va Banque“ nicht so und so viele Zuschauer findet“. Und wütender werdend: „Ich bequatsche in Zukunft lieber eine verrückte Gräfin oder einen Idioten und lass mich auf deren Macken ein, als dass ich mich nochmal auf so ein pseudodemokratisches Elf-Leute-System von Kirche-bis-Gewerkschaft-können-nicht-irren mit dieser atmosphärischen Korruption einlasse. Das ist widerlich und inhuman und menschlich wie künstlerisch entwürdigend“.